DISS-Kolloquium 2019: Entfremdung, Identität und Utopie
Akademie Frankenwarte Würzburg (22.11.-24.11.2019)
Das diesjährige Kolloquium des Duisburger Instituts für Sprach- und Sozialforschung (Tagungsort: Akademie Frankenwarte, Würzburg, 22.-24. November 2019) ist der Trias von Entfremdung, Identität und Utopie gewidmet.
Damit werden gesellschaftstheoretische und gesellschaftskritische Fragestellungen aufgegriffen, die in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen haben. Das Kolloquium thematisiert die gesellschaftlichen und diskursiven Kontexte, in denen diese Fragestellungen aufgeworfen werden, und will die theoretische und politisch-praktische Relevanz dieser kategorialen Trias überprüfen.
Die Debatte um den Entfremdungsbegriff reflektiert zum einen das neue Interesse an der Marx-Lektüre, das seit der Jahrtausendwende Ausdruck der Krisenprozesse ist, die die kapitalistische „Welt“ durchziehen und nach Erklärungsmustern suchen lassen. In diesem Zusammenhang wird das Verhältnis zwischen dem „frühen“ Marx und dem Marx der „Kritik der Politischen Ökonomie“, zwischen Entfremdungskritik und der Kritik des Warenfetischismus erneut thematisiert. Zum anderen verweist der Entfremdungsdiskurs auf die individuellen Leidenserfahrungen, die den Alltag der Menschen bestimmen.
Korrespondierend zum Entfremdungsbegriff nimmt der Identitätsbegriff einen immer breiteren Raum ein in der Debatte um die Gestaltung von nichtentfremdeten Lebensverhältnissen. ‚Identität‘ (bzw. ‚kollektive Identität‘) ist zur Chiffre geworden, unter der sich unterschiedliche Gruppen formen, denen es um eine Änderung vorherrschender Lebens- und Denkweisen geht, die sich unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen herausgebildet haben. Die jeweiligen Gemeinschaftsvorstellungen, ihre Begründungen und Handlungsstrategien werden seit einigen Jahren breit und kontrovers erörtert. Auf Seiten der Linken stellt sich speziell die Frage, wie Identitäts- und Klassenpolitik zueinander stehen. Demgegenüber erheben rechtspopulistische und extrem rechte Bewegungen das „Deutsch-Sein“ (im völkischen Sinne) und das volksgemeinschaftliche Wir zum allein bestimmenden Identitätsmerkmal.
Die Diskussion zum Entfremdungs- wie auch zum Identitätsbegriff nehmen die Vorstellungen von einer anderen, besseren Welt auf. Seit Karl Mannheim und Ernst Bloch wird Utopie nicht mehr primär als ein literarisches Genre („Staatsromane“, „soziale Utopien“), sondern als eine Denkform, als „utopisches Bewusstsein“ (Karl Mannheim) betrachtet, die es für kultur- und sozialwissenschaftliche Analysen fruchtbar zu machen gilt. Gefragt wird danach, inwieweit sich Utopie von Ideologie unterscheiden lässt, sowie allgemein nach der sozialen Funktion von Utopien. Es stellt sich die Frage, inwieweit der Begriff des Utopischen geeignet ist, eine motivierende, mobilisierende und verändernde Kraft zu entfalten.
Programm
Aktuelle Konfliktlinien innerhalb der Linken. Zur falschen Entgegensetzung von Klassenpolitik und Identitätspolitik
Stefanie Graefe, Jena
Von der Entfremdungskritik zum Fetischbegriff. Karl Marx‘ gesellschaftskritische Kategorien. Deutungen und Kontroversen
Wolfgang Kastrup, Duisburg
Neuere Entfremdungstheorien bei Rahel Jaeggi, Hartmut Rosa und Axel Honneth
Marvin Müller, Münster
Identitätspolitik: Herausbildung, Deutungsformen und kollektive Bewegung
Peter Höhmann, Mülheim/R.
Identitätspolitiken: Konzepte und Kritiken in Geschichte und Gegenwart der Linken
Lea Susemichel, Wien
Klassenkampf statt Diversity-Programme
Eleonora Roldán Mendívil / Bafta Sarbo, Berlin
„Die Hauptfront des zwanzigsten Jahrhunderts verläuft zwischen Identität und Entfremdung.“ Über rechte Entfremdungskritik und Identitätspolitik
Helmut Kellershohn, Duisburg
„Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen.“ Ein Plädoyer für Mehrsprachigkeit
Jörg Senf, Rom
Utopisches Denken. Anmerkungen zum Utopie-Begriff in den Sozialwissenschaften
Marvin Chlada, Duisburg
Die Bestimmung „notwendiger Arbeit“ als Kampffeld für „revolutionäre Realpolitik“
Jutta Meyer-Siebert, Hannover
Gewalt – Autonomie – Utopie
Andreas Kemper, Münster
Anmeldungen
Akademie Frankenwarte, Würzburg, Tel.: 0931/80464-347 oder E-Mail: julia.reuss@frankenwarte.de
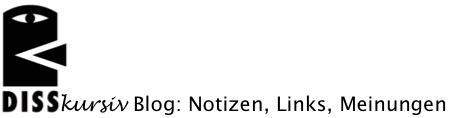

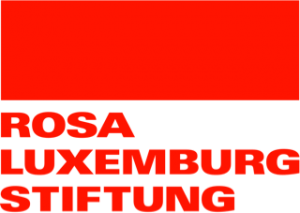
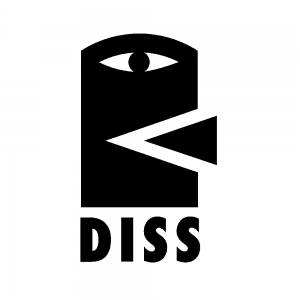

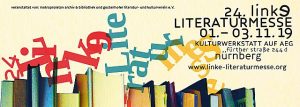
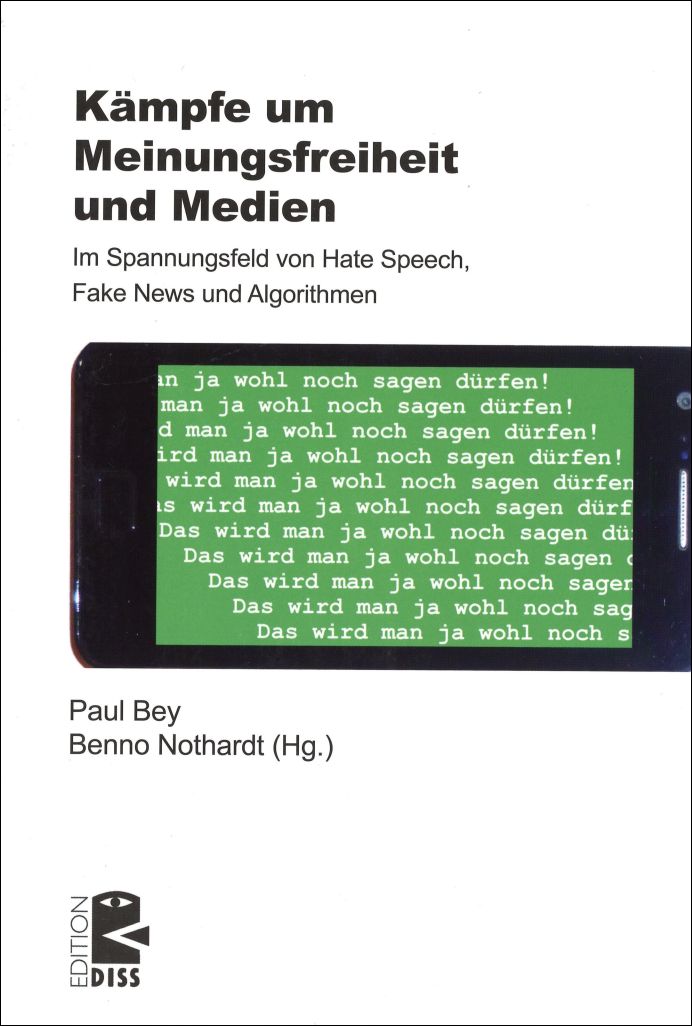
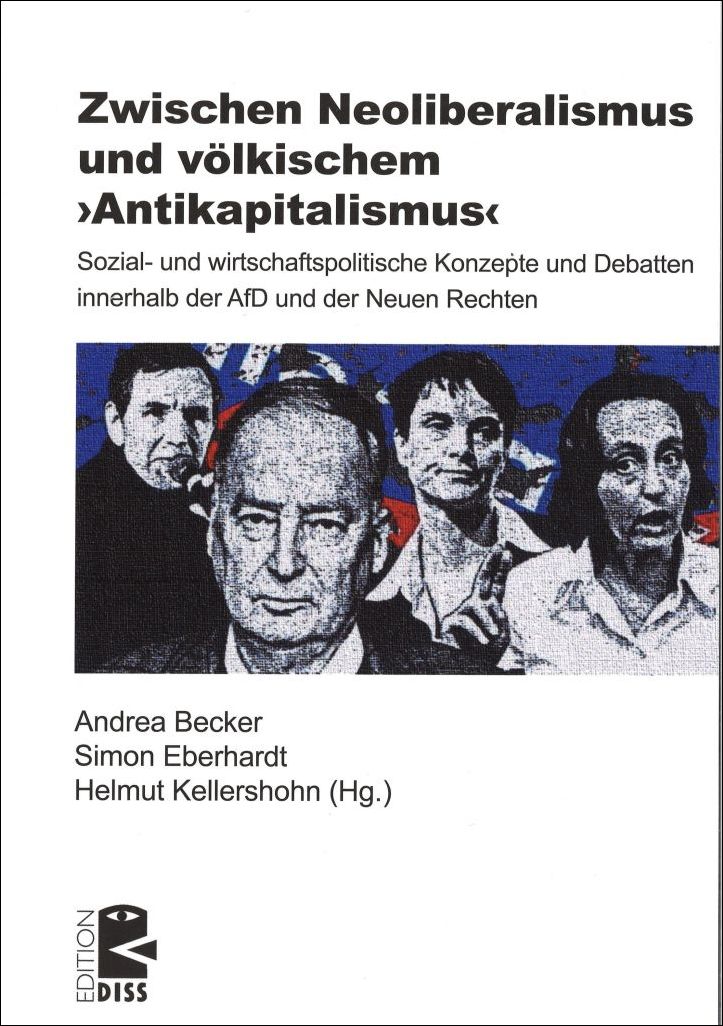

 23.-25.11.2018 in der Akademie Frankenwarte in Würzburg
23.-25.11.2018 in der Akademie Frankenwarte in Würzburg