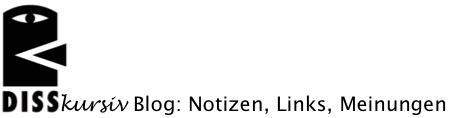- Rede von Frau Ministerin Dr. Angelica Schwall-Düren
- aus Anlass der Präsentation der Edition „Schriften deutsch-jüdischer Autoren des 19. Jahrhunderts zu den Themen Staat, Nation, Gesellschaft“ (21. Februar 2011, Alte Synagoge Essen)
- Es gilt das gesprochene Wort!
- I.
- Sehr geehrter Herr Professor Jäger,
- sehr geehrter Herr Professor Brocke,
- sehr geehrter Herr Dr. Paul,
- sehr geehrter Herr Professor Schlüter,
- sehr geehrte Damen und Herren,
- zur Vorbereitung auf die heutige Veranstaltung wurde ich auf ein kleines Bändchen aufmerksam gemacht. Ein Bericht von einer Tagung. Genauer gesagt: Von einem Vortrag bei dieser Tagung. Thema: „Jüdische Identität und jüdisches Schicksal.“ – Das war interessant, weil Ende der 90er Jahre alle Welt darüber diskutierte, wann Menschen sich als „Gemeinschaft“ empfinden. Wann – so das Schlagwort in der Wissenschaft – von einer „kollektiven Identität“ gesprochen werden kann.
- Sie können sich vorstellen: Eine solche Debatte ist immer spannend. Denn da geht es ja nie nur um die Frage: Wer gehört dazu? Sondern da geht es immer auch darum: Wer soll nicht dazugehören? Wer soll draußen bleiben? Oder ausgestoßen werden? Und wenn dann jemand über „jüdische Identität“ oder „jüdische Kultur“ spricht – dann wird es besonders interessant. Dann erregt das in besonderer Weise Aufmerksamkeit. Weil sich da nämlich in besonderer Weise die Frage aufdrängt: Was sind die selbst empfundenen Gemeinsamkeiten – und was die zugeschriebenen? Was begründet das Selbstbild einer Gruppe? Und welches Fremdbild existiert von ihr? Vor allem aber: Wie wirkt sich das eine auf das andere aus?
- In dem Vortrag ging es aber noch um etwas anderes. Es ging um eine These, die mehr als provokant war. Die in ihrer Radikalität Widerspruch hervorrufen musste. Vertreten wurde diese These von dem in Wien geborenen Kunsthistoriker Ernst Gombrich. Gombrich – selbst jüdischer Herkunft – sagte: „Natürlich weiß ich von vielen äußerst kultivierten Juden, aber … ich bin der Meinung, dass der Begriff der jüdischen Kultur von Hitler und seinen Vor- und Nachläufern erfunden wurde.“ – Zitat Ende.
- Damit nicht genug. Weiter hieß es in dem Vortrag: Eindeutig sei, so Gombrich, für ihn nur der Begriff des Judentums als einer Religion. Nicht aber als Kultur. Gombrich bezweifelte zwar nicht die Eigenständigkeit der Kultur beispielsweise ostjüdischer Gemeinden. Aber, so die Auffassung des Kunsthistorikers: Im Selbstverständnis vieler oftmals liberaler Juden in Deutschland und Österreich habe es keine Vorstellung einer gemeinsamen jüdischen Kultur gegeben.
- II.
- Sehr geehrte Damen und Herren,
- Gombrichs Analyse ist wichtig. Weil sie den Blick schärft für den Unterschied zwischen Kultur und Religion. Und weil gerade im 19. Jahrhundert nicht wenige Juden sich in die Diskussion über Staat, Nation und Gesellschaft einmischten – und zwar unter ausdrücklichem Verweis auf ihr Judentum. Auf ihren jüdischen Glauben. Gerade deshalb kann ein Projekt wie das heute hier vorgestellte auf mehre Bände angelegte sein. Gerade deshalb passt es nicht in das Format eines Taschenbüchleins. Und gerade deshalb halte ich die Auseinandersetzung mit Gombrichs These auch weiterhin für wichtig. Weil sie ein Kernproblem berührt. Denn was ist das: „Jüdische Kultur“? Was ist „jüdische Religion“? Was ist „jüdische Identität“?
- Das sind ja keine akademischen Fragen. Im Gegenteil. Aus vielen Gesprächen mit Menschen unterschiedlicher Religionen, mit Christen und Juden gleichermaßen, weiß ich: Je größer der zeitliche Abstand zum Holocaust wird, je mehr sich die Auseinandersetzung mit der industriellen Ermordung und Vernichtung der Juden Europas in die Geschichtsbücher verlagert, je weniger Zeitzeugen berichten können über Grauen und Schrecken der Lager – desto drängender, desto schmerzhafter brennt die Frage, was „jüdisch sein“ heute heißt. Was es heute heißen kann. Und was es für uns heute heißen muss.
- Es gibt ja nicht wenige, die da ganz schnell eine Antwort haben. Die sagen: Ja – Juden haben einen wesentlichen Beitrag zu Kunst, Wissenschaft, Gesellschaft geleistet. Aber – so wird dann argumentiert – das alles haben sie aus der jeweiligen sozialen und wirtschaftlichen Stellung in der Gesellschaft heraus getan. Sicher: Man darf diese Dimension nicht ausblenden. Aber man darf eben auch andere Aspekte nicht übersehen. Denn sonst würden wir Juden ein weiteres Mal zu Opfern machen. Mehr noch: Wir würden sie auf den Opferstatus reduzieren. Und damit wären wir einmal mehr dort angekommen, wo die Völker Europas, wo Deutschland lange, viel zu lange gestanden hat: In einer Position der herablassenden Dialog-Verweigerung. Des entwürdigenden Nicht-Gesprächs.
- III.
- Sehr geehrte Damen und Herren,
- Sie merken: Der Vortrag von Gombrich hat mich bewegt. Und er war für mich Anlass, noch ein wenig zu recherchieren. Ein wenig zu lesen. Über die Hintergründe der Diskussion damals. Darüber, dass Gombrich letztlich nur reagierte auf ein neu erwachtes Interesse am Wiener fin-de-siècle. An der Idee von „Mitteleuropa“. Daran, was die Seele unseres Kontinents ist. Was Europa zusammenhält. Was Gemeinschaften überhaupt verbindet und entstehen lässt.
- Es gab damals nicht wenige, die überzeugt waren: Die Antwort liegt – zumindest bezogen auf das Wiener fin-de-siècle – in der Rolle, die das bürgerliche Judentum im 19. Jahrhundert spielte. Es gab nicht wenige, die überzeugt waren vom herausragenden Einfluss der bürgerlichen Juden. Weil sie sahen, wie diese Gruppe sich um eine völlige Integration in die Gesellschaft bemüht hätte. Auch wenn sie damit letztlich gescheitert seien. Aber trotzdem wurde anerkannt: Dieses Bemühen hatte gleichwohl Einfluss. Und ohne diese Juden – so die Annahme weiter – wäre das europäische Denken weiterhin in Provinzialität verfangen geblieben. Ohne sie hätten die Kategorien modernen rechtsstaatlichen Denkens nicht entwickelt werden können.
- Andere wiederum – darunter eben auch Gombrich – warnten vor dem Mythos einer spezifisch jüdischen Kultur in Europa. Und sie hielten eine grundsätzlichere Frage für weitaus bedeutsamer: Nämlich, was Gemeinschaften heranwachsen lässt. Wie sich kollektive Identität bildet. Oder besser: Wie es zu „geglaubten Gemeinsamkeiten“ kommt.
- IV.
- Sehr geehrte Damen und Herren,
- wir müssen diese Debatte nicht wieder aufleben lassen. Aber einige Kernfragen beschäftigen mich doch bis heute. Und offenbar beschäftigen sie auch andere. Der heutige Tag bestätigt das. Die Fragen von damals sind immer noch präsent. Sie kommen nur in anderem Gewand daher. Zum Beispiel, wenn es um den Beitrag deutsch-jüdischer Autoren des 19. Jahrhunderts zu Staat, Nation und Gesellschaft geht. Wenn es um die Entwicklung sozialethischer Positionen geht. Denn wer über einen Beitrag – nicht nur zu diesen Themen – spricht, der setzt ja – gewollt oder nicht – vieles bereits voraus: Der setzt voraus, dass wir zwar vielleicht nicht wissen, was genau Sozialethik ist – aber dass wir doch zumindest glauben, uns gemeinsam auf einen Begriff von „Sozialethik“ verständigt zu haben. Dass wir zwar nicht genau wissen, was genau eine „deutsche“ oder eine „jüdische“ Sozialethik ist – aber dass wir doch zumindest glauben, uns gemeinsam darauf verständigt zu haben, was wir unter dem spezifisch „deutschen“ oder „jüdischen“ der Sozialethik verstehen wollen.
- Tatsache ist aber: Wo im 19. Jahrhundert die einen „deutsch“, die anderen „christlich“ sagten, da schlossen sie damit ganz überwiegend und ganz gezielt Juden aus. Wir wissen, dass es nicht bei Ausgrenzung bleiben sollte. Und vielleicht ist es das, was mich erzürnt: Wenn „jüdisch“ von „deutsch“ getrennt wird. Damit gibt man zu verstehen, dass jüdisch nicht deutsch sein kann. – Und heute? Sicher gibt es diese Form des Antisemitismus immer noch. Aber heute neigen wir doch dazu, das Jüdische zu vereinnahmen. Wir tun uns schwer, Unterschiede zu benennen. Weil wir im Differenzieren schnell auch ein Diskriminieren sehen.
- Meine Sorge ist nur: Im einen wie im anderen Fall läuft es darauf hinaus, dem Jüdischen seinen Platz streitig zu machen. Entweder, weil es als eigenständige Kraft abgelehnt wird. Oder ihm eben seine Eigenständigkeit abgesprochen wird.
- V.
- Sehr geehrte Damen und Herren,
- ich möchte mich in den wissenschaftlichen Teil dieser Diskussion nicht einmischen. Das soll den Experten vorbehalten bleiben. Aber ich möchte doch drei politische Akzente setzen. Erstens: Ich bin überzeugt: Alles das, was wir „Sozialethik“ oder „Soziallehre“ nennen, was sich niedergeschlagen hat in dem, was wir Sozialstaat nennen, was unserem Verständnis von Solidarität zugrunde liegt, ist nicht zu denken ohne einige Grundannahmen. Diese Grundannahmen mögen zwar vielleicht nicht allein und ausschließlich einer wie auch immer zu definierenden „jüdischen Kultur“ innewohnen. Aber: Sie sind der jüdischen Religion als Grundpfeiler eingeschrieben. Und ohne sie wäre auch die jüngere Schwester des Judentums, das Christentum, nicht denkbar.
- Sehr geehrte Damen und Herren,
- ich spreche von der Vorstellung, dass der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen worden ist. Und dass sich aus dieser Ebenbildlichkeit eine Pflicht ableitet. Den Menschen nämlich nicht nur als Geschöpf zu betrachten. Sondern in ihm immer auch den Bruder und die Schwester zu sehen. Ihm in Nächstenliebe zu begegnen. In politische Münze geprägt, mit den Worten der französischen Revolution: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Oder eben mit dem spröden Charme des Staatsrechtlers: Gleiches Recht für alle.
- In Tagen, in denen betriebswirtschaftliche Logiken immer weiter um sich greifen, ist das Wissen um diese zutiefst menschliche, das Humanum in den Blick nehmende Vorstellung von unschätzbarem Wert.
- Zweitens: Ich bin überzeugt: Es gibt Traditionen im Judentum, die wir heute vielleicht dringender denn je brauchen. Ich rede von der Fähigkeit zur Selbstkritik. Vom Willen zur intellektuellen Freiheit. Von der Fähigkeit, fremde Positionen zu durchdringen und zu verstehen. Selbstverständlich: Auch das sind Traditionen, die zu sehen sind vor einer seit dem Mittelalter andauernden Geschichte der Diskriminierung. Eine Geschichte,in der wir es zu tun haben mit Herablassung, Verweigerung und Belehrung auf der einen Seite. Auf der Seite der Mehrheitsgesellschaft. Und mit Analysen, Argumenten und wohlmeinenden Anreden auf der anderen Seite.
- Genau genommen, meine Damen und Herren, sind diese Traditionen aber viel älter. Und sie sind nirgends mehr kultiviert worden als im Judentum. Ich bin deshalb dankbar, dass jüdisches Leben in Nordrhein-Westfalen seit vielen Jahren wieder lebendig ist. Dass jüdisches Leben sichtbar ist. Dass es wieder zahlreiche Synagogen gibt. Jüdische Schulen. Jüdische Kindergärten. Dafür bin ich dankbar.
- Drittens schließlich bin ich überzeugt: Wir können die Debatte über den jüdischen Beitrag zu unseren sozialethischen Traditionen nicht in einem geschichtslosen Raum führen. Denn völlig losgelöst von der Frage, wie dieser Beitrag ausgesehen haben mag: Schmerzhafte Tatsache ist und bleibt: Die Trägerinnen und Träger dieses Beitrages wurden verfolgt, entrechtet und ermordet. „Die Symphonie ist aus“, hat Gershom Scholem 1962 zermürbt festgestellt. Und deshalb gehört es wahrscheinlich zu den traurigen Absurditäten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass das Wissen um die jüdischen Beiträge weiter schwindet.
- VI.
- Sehr geehrte Damen und Herren,
- umso dankbar bin ich, dass heute die Edition „Deutsch-jüdische Autoren des 19. Jahrhunderts“ vorgestellt werden kann. Und ich möchte Sie ermutigen, an dieser Thematik weiterzuarbeiten. Sie leisten einen wichtigen Beitrag, damit die kranken Ideen von Gestern nicht in den Wirrköpfen von heute weiterleben. Und dass die wenigen Töne der Symphonie, die noch nachklingen, nicht übertönt werden vom Dröhnen der Springerstiefeln. Und auch nicht verschluckt werden vom Schweigen der Mehrheit. Sie tragen mit Ihrer Arbeit dazu bei, dass nicht vergessen wird. Und das ist – jenseits allen wissenschaftlichen Wertes Ihres Tuns – wohl das Wichtigste, was Sie hier leisten können und auch tatsächlich leisten: Dass wir es als elementaren Bestandteil eines verantwortbaren Umgangs mit unserer Vergangenheit betrachten, der Ermordeten zu erinnern. Und dass es eine ebensolche Pflicht ist, das wach zu halten,was unserem ganzen Miteinander an Menschlichkeit, aber auch an Modernität, an Achtung der Menschenwürde, aber auch an Aufklärung eben über den jüdischen Glauben seit Jahrhunderten eingeschrieben worden ist. Und zwar – erlauben Sie mir diese selbstkritische Note – schon ein wenig länger, als das im Christentum der Fall ist. So lang, dass Johannes Rau vielleicht sogar Recht hatte, als er meinte: Es sei zutreffender, von jüdischer, statt von christlicher Nächstenliebe zu reden.
- Sehr geehrte Damen und Herren,
- ich möchte mit einem Wunsch schließen. Ich wünsche Ihnen und uns, dass Ihre Arbeit dazu beiträgt, endlich damit beginnen zu können, was auch Gershom Scholem so schmerzlich vermisste: Den Dialog. Das Gespräch. Vielleicht, nein: Ich bin sicher – heute ist damit eine wichtige Grundlage geschaffen.
Zum Inhalt springen
Blog des Duisburger Instituts für Sprach- und Sozialforschung