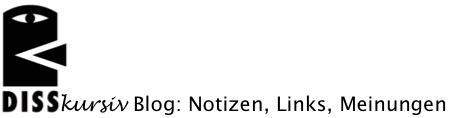nd, 25.7.2023, S. 4
Benno Nothardt über das »Feindbild junger muslimischer Mann« und sinnvolle Integrationsstrategien
• Interview: David Bieber
Vielfach hört man, wir hätten in unserer Gesellschaft ein Problem mit jungen muslimischen Männern. Sie widersprechen …
Unser Institut hat schon 2015 beobachtet, dass das Feindbild »junger muslimischer Mann« in den Medien eine wichtige Funktion für das Kippen von der Willkommenskultur in eine Notstandstimmung hatte. Besonders deutlich wurde das bei der Debatte über sexualisierte Übergriffe in der Silvesternacht von 2015 auf 2016 in Köln. Um die Wirkung dieser Zuschreibung zu verstehen, hilft der Begriff Ethnisierung von Sexismus, den Margret Jäger schon vor mehr als 25 Jahren erarbeitete. Gemeint ist damit, dass patriarchales Verhalten oder sexualisierte Gewalt als ethnisches Merkmal beziehungsweise typisch muslimisches Verhalten konstruiert und zugeschrieben wird. In den zurückliegenden Jahren gewinnt die ähnlich strukturierte Ethnisierung von Kriminalität an Bedeutung, etwa in der Debatte über die Ausschreitungen der vergangenen Silvesternacht. Solche Zuschreibungen erklären nichts, sondern verorten Gewalt in einer Gruppe, die man somit ausgrenzen kann. Sie sind aber auch schmerzhaft für junge Männer, die aufgrund ihres Aussehens ständig befürchten müssen, als potenzielle Vergewaltiger oder Gewalttäter behandelt zu werden. Nicht junge muslimische Männer sind das Problem, sondern vielmehr, dass ihnen problematische Eigenschaften zugeschrieben werden, die es auch in anderen Teilen unserer Gesellschaft gibt.
Wie würde man es schaffen, diese jungen Männer besser zu integrieren und welche Fehler haben Staat und Behörden in Deutschland bisher gemacht?
Als Diskursanalytiker*innen können wir keine Integrationskonzepte erstellen oder anordnen. Aber wir können zeigen, wie ausgrenzende Zuschreibungen und aufgeheizte Debatten gerade die Menschen treffen, die sowieso schon unter Ausbeutung und Segregation im ungezügelten Kapitalismus leiden. Und wir können zeigen, wie problematisch es ist, wenn eben muslimische junge Männer nicht als Teil unserer Gesellschaft gesehen werden, also als Teil eines »Wir«, sondern per se als Delinquenten. Insofern ist es wichtig, mit Communitys und Personen direkt zu sprechen und nicht über sie, denn ihre Perspektive muss maßgeblich sein. In diese Richtung gehen Konzepte partizipativer Sozialarbeit, die ihr Gegenüber als politische Akteure ernst nehmen und sie vor allem auch darin bestärken, für ihre Rechte und Anliegen einzutreten.
Wie beurteilt Ihr Institut die mediale Berichterstattung über die sogenannten Silvester-unruhen oder aktuell über Schlägereien in Freibädern?
Ein Projektteam im DISS hat zumindest zu Silvester 2022/2023 eine kleine Medienuntersuchung gemacht. Dabei wurde deutlich, dass die Ereignisse hauptsächlich als Anlass für darüber hinausgehende politische Forderungen genommen wurden. In den Darstellungen von »Bild« bekommt man den Eindruck, es herrschten kriegsähnliche Zustände. Und »Bild« und »Frankfurter Allgemeine« glorifizierten angegriffene Polizei- und Rettungskräfte. Beide Medien ethnisieren Kriminalität und betonen eine Wertedifferenz zwischen einer angeblich kriminellen muslimischen Minderheit und einer vermeintlich unschuldigen Mehrheit der Gesellschaft. Als Konsequenz daraus werden in der »FAZ« schnellere oder härtere Strafen gefordert, während »Bild« die Abschiebung krimineller Migrant*innen fordert. Die Debatte in beiden Zeitungen war rassistisch aufgeheizt. Die »Taz« hingegen kritisiert diesen Rassismus und benennt in zwei Kommentaren auch unangemessenes Polizeiverhalten als mögliche Ursache für die Ereignisse. Trotzdem wird auch hier neben sozialen Maßnahmen vor allem ein restriktives Vorgehen seitens der Polizei und direkte Bestrafung gefordert. Dabei wird übersehen, dass dies häufig Auswirkungen auf Menschen hat, die als migrantisch wahrgenommen werden, etwa durch Racial Profiling.
Vor allem in konservativen Kreisen wird beklagt, sobald man unangenehme Wahrheiten anspreche, werde der Rassismusvorwurf erhoben – und als Totschlag-Argument genutzt. Wie sehen Sie das?
Es handelt sich dabei um einen Abwehrmechanismus: Kritik an rassistischen Strukturen wird umgedeutet als angebliches Sprechverbot, gegen das man sich dann wehrt. Außerdem wird unterstellt, die Debatte über die angeblich wahren Probleme solle so unterbunden werden. Doch das ergibt nur Sinn, wenn man davon ausgeht, dass die wahren Probleme Migration und Islam sind und nicht etwa Rassismus, soziale Ungerechtigkeit oder patriarchale Strukturen.
Was sollten Redaktionen tun, um Gewalt in ihrer Berichterstattung nicht zu stark zu ethnisieren?
Es ist schon viel erreicht, wenn Journalist*innen eventuell auch ungewollte rassistische Effekte reflektieren. Wenn man an die Asyldebatte der 1990er Jahre und die Diskurse zum Brandanschlag in Solingen 1993 oder über die Pogrome in Rostock-Lichtenhagen zurück-denkt, kann man sagen, dass die Sensibilität bei einem Teil der Journalist*innen deutlich gestiegen ist. Allerdings fällt bei der Silvesterdebatte auf, dass linke Medien zwar benennen, dass rassistische Strukturen ein zentrales Problem sind, dann aber doch restriktive Maßnahmen statt besserer sozialer und antirassistischer Konzepte fordern. Es lohnt sich auch, darauf zu achten, welche »Wir«- und »Fremd«-Gruppen in Zeitungstexten konstruiert werden. Ob die Grenze zwischen Christ*innen und Muslim*innen, rechtschaffenen Bürger*innen und Kriminellen oder Erwachsenen und delinquenten Jugendlichen gezogen wird: Es kommt in allen Fällen zur Konstruktion eines ausgrenzenden »Wir«. Das zu reflektieren ist aber nur die halbe Miete. Außerdem sollten Redaktionen möglichst plural besetzt sein, es sollte häufig Gastbeiträge und Reportagen geben, in denen auch Menschen zu Wort kommen, die von Ethnisierung betroffen sind.
Benno Nothardt engagiert sich ehrenamtlich im Arbeitskreis Migration des Duisburger Instituts für Sprach- und Sozialforschung (DISS). Das vor 35 Jahren gegründete Institut forscht zu gesellschaftlich relevanten Themen wie Rechtsextremismus, Migration, Geschlechterdiskurse, Antisemitismus und Rassismus gegen Sinti*zze und Rom*nja.
online veröffentlicht 24.7.2023: https://www.nd-aktuell.de/artikel/1174992.feindbild-muslime-kriminalitaet-wird-ethnisiert.html
zugleich in der Printausgabe des Neuen Deutschland (nd), 25.7.2023, S. 4