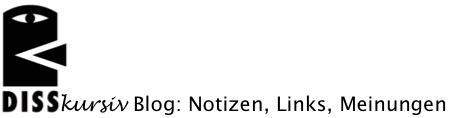DISS-Vortrag in Hattingen
Fast auf den Tag zum 205. Geburtstag, am 2. Mai 2010, erinnerte Jobst Paul (DISS) in einem Vortrag in Hattingen an die denkwürdige Biographie des Königsberger Arztes, Publizisten und Bürgerrechtlers Johann Jacoby (1805-1877). Jacoby, der zwischen 1840 und 1870, also über Jahrzehnte für soziale Gerechtigkeit, aber auch für Freiheitsrechte kämpfte und zeitweise zum persönlichen Gegenspieler Bismarcks wurde, wollte zwar als nicht-religiöser Jude verstanden werden, orientierte sich aber gleichwohl an den konsequenten Gleichheitstheoremen der jüdischen Sozialethik. Ruth Jacoby, die schwedische Botschafterin in Berlin und Verwandte Johann Jacobys, war in Hattingen anwesend. ((Vgl. auch: Der Westen: Johannes-Gemeinde. Schwedische Botschafterin zu Besuch, Hattingen, 03.05.2010, Hendrik Steimann ))
Johann Jacoby – Bürgerrechtler
Johann Jacoby hat sich zeitlebens extreme menschliche und politische Spannungen zugemutet, oder besser: er hat sich oft kompromisslos in die Spannungen seiner Zeit hineingeworfen. Es ist deshalb kein Wunder, wenn diese Spannungen auch noch ganz am Schluss, nämlich bei Jacobys Begräbnis am 11. März 1877, aufbrachen:
„Schon Mittags – so ein Augenzeuge – war das Volk von Königsberg auf dem Universitätsplatze und in den umliegenden Straßen in unzähligen Massen erschienen; Deputationen der socialistischen Partei Deutschlands, der Arbeiter Berlins, Breslaus, Hamburgs, Cölns, Braunschweigs und anderer Städte, der Arbeiterfrauen Berlins, der „Berliner Freien Presse“, der „Frankfurter Zeitung“, sowie Abgesandte der demokratischen Vereine von Berlin und von Frankfurt a. M., vom Königsberger Handwerkerverein, von der schwäbischen Volkspartei u. s. w., u. s. w. hatten sich vor dem Hause Jacoby’s aufgestellt und hielten riesige Lorbeerkränze in den Händen.“
Berichtet wird von 5000 Trauergästen allein in Königsberg (Gedenkveranstaltungen gab es auch in anderen deutschen Städten). Ursprünglich planten die Vertreter der „Fortschrittspartei“ eine Art Kundgebung am Grab. Da aber die jüdische Gemeinde dort nur kurze Erklärungen duldete, drängten sie sich schon zuvor, nämlich „hinter dem Leichenwagen möglichst auffällig in den Vordergrund.“
Die jüdische Gemeinde befürchtete aber auch eine innere Zerreißprobe. Jacoby hatte sich stets als nicht-religiös positioniert. Wie sollte sich Rabbiner Isaac Bamberger in seiner Ansprache dazu stellen? Es kam alles ganz anders: Rabbiner Bamberger fand sehr verbindliche Worte, während letztlich alle Vertreter der vielen Verbände nicht kurze Erklärungen abgaben, sondern Ansprachen hielten und dabei Jacoby politisch jeweils für sich reklamierten.
Eine knappe Skizze und doch drängen sich bereits Fragen auf. Wobei wir die wichtigste nur andeuten wollen: Wie kann es sein, dass Johann Jacoby, offenbar eine der zentralen Gestalten, ja eine Ikone seiner Zeit und dies über Jahrzehnte hinweg – wie kann dieser Mann heute vergessen sein? Blicken wir zunächst noch einmal auf die geschilderte Episode, um vielleicht einiges, für Jacoby Typisches gleich in Worte – und in Thesen – zu fassen. Von dort werfen wir in aller Kürze einen Blick auf Jacobys Biographie.
Auffällig sind z.B. die unterschiedlichen politischen Lager und Organisationen. Jacoby erscheint als Integrationsfigur, nicht als Bekenner für eine ideologisch genau verortbare Meinung, auch nicht als Anführer (der Sozialdemokratie schloss er sich erst wenige Jahre vor seinem Tod an). Vielmehr unterstützt oder schmiedet er Allianzen, mit Blick auf die zu stürzende, in Deutschland, vor allem in Preußen im Sattel sitzende Autokratie.
Es ist eine bewusst aktivistische Haltung, die wir heute – die friedliche Revolution von 1989 vor Augen – als die eines Bürgerrechtlers bezeichnen würden und zu der sich Jacoby auch offen bekannt hat, als Rolle, die die Zeit erforderte und die ihm auf den Leib geschnitten schien.
Kein Wunder, dass die spätere konservative Geschichtsschreibung Preußens, im Bewusstsein ihres Sieges über alles, was mit Bürgerrechten zu tun hatte, nach Jacobys Tod zwei Charakterzüge hervorhob, die ihn – ihrer Meinung nach – für einen Platz in den Annalen disqualifizierte. Erstens habe er nur opponiert und zweitens habe er von der Verehrung der breiten Massen profitiert, und all das sei nichts Konstruktives – man hört die judenfeindlichen Klischees heraus. Kühl hält ihm Karl Wippermann im Jahr 1881 in der Allgemeinen Deutschen Biographie vor: Er sei völlig wirkungslos geblieben.
Jacoby wurde am 1. Mai 1805, also gestern vor 205 Jahren, als Sohn eines jüdischen Geschäftsmannes in Königsberg geboren, besuchte dort 1815–23 das Friedrichskolleg und danach die Universität. Er entschied sich für Medizin – oder sah für sich als Juden nur diese Möglichkeit. Immerhin focht er erfolgreich gegen die Diskriminierung jüdischer Studenten. Jacoby promovierte und legte 1828 das medizinische Staatsexamen ab, im Jahr übrigens, in dem die preußische Regierung Juden verbot, „christliche“ Vornamen zu führen. Bereits 1830, also im Alter von 25, praktizierte Jacoby als Arzt in Königsberg.
Dann folgte die Pariser Julirevolution von 1830, ein Paukenschlag. Für eine ganze Generation, auch für Jüngere wie Georg Büchner, schien plötzlich eine epochale Wende zu Freiheit und Demokratie in ganz Europa gekommen, die reaktionären Mächte schienen für immer besiegt.
Was dann geschah, hat sich in den Biographien vieler Tausender von jungen Leuten, auch in Johann Jacobys Biographie, wie eine gemeinsame Fieberkurve niedergeschlagen. Für dieses ‚junge Deutschland’ ist die Phase von 1830 bis 1840 geprägt von offenem, optimistischen Widerstand, dann – nach 1840 – schon vom verzweifelten Ringen mit den Obrigkeiten, insbesondere auch mit der preußischen Verwaltung. Der gescheiterten Revolution von 1849 folgt – bis 1858/59 – eine Phase des Rückzugs und gleichzeitig der ökonomischen Emanzipation des städtischen, auch jüdischen Bürgertums. Und nicht zu vergessen: Viele der fähigsten Leute schmachten – aufgrund von Urteilen nach 1848/49 – jahrelang in den Verliesen, oder sind – oft nach Übersee – geflohen.
Nicht wenige von ihnen kehren zurück und viele Aktivisten von 1848/49 treten erneut an, als sich zwischen 1858 bis 1866 in Deutschland eine exzellent organisierte Demokratiebewegung nach dem Vorbild Garibaldis formiert, mit dem Fürsten von Coburg-Gotha als Anführer, der mit vielen europäischen Fürstenhäusern verwandt ist. Im Jahr 1866, mit dem Schlag gegen Österreich, zerschlägt Preußen auch diese Bewegung. Dies war ein brutaler Willkürakt und es blieb ein schwerer Makel der Reichsgründung und des Kaiserreichs insgesamt. Jacoby ist übrigens einer der ganz wenigen ‚Bürgerrechtler’, die sich nach 1866 nicht zurückzogen. Bis heute sind, abgesehen vom Revolutionsjahr 1848, die zwei historischen Phasen eines Aufbruchs von unten, zwischen 1830 und 1840, und zwischen 1858 bis 1866, als sich der deutsche Nationalverein etablierte, im historischen Bewusstsein der Deutschen kaum präsent.
Johann Jacobys weitere Biographie, die sich vor diesem Hintergrund entfaltet, kann man nicht in wenigen Sätzen zusammenfassen. Man meint in der Tat je einem anderen Menschen zu begegnen, wenn man Lebensbeschreibungen liest, die Jacoby schwerpunktmäßig als Mediziner, als Publizisten, als Rechts- oder Sozialpolitiker, als Parlamentarier, Pazifisten und Internationalisten, als Moralisten oder Aktivisten, oder auch als Briefschreiber und Rhetoriker vorstellen. Ich will nur kurz anreißen, was ihn bei breiten Bevölkerungsschichten zum Helden machte:
Seine politische Radikalisierung, die Ausbildung seiner klar urteilenden politischen Rhetorik ist datierbar. Zwischen 1830 und Sommer 1840 kritisiert Jacoby das preußische Regime vor allem als Mediziner – er kämpft für fachliche Alternativen, etwa was die Cholera in Polen und die Hygiene an Schulen betrifft. Und genau mit dem Machtantritt des neuen preußischen Königs Friedrich Wilhelm IV., des personifizierten Mittelalters auf dem Thron, wird Jacoby zum politischen Aktivisten. Und das sind für ihn die Folgen:
1841-43 Prozess wegen Hochverrats. Grund ist die anonyme Flugschrift »Vier Fragen beantwortet von einem Ostpreußen« von 1841. 1842 Urteil auf zweieinhalb Jahre Festung, 1843 Freispruch.
1845-47 Prozess wegen Majestätsbeleidigung und frechen Tadels der Landesgesetze wegen der Denkschriften »Das königliche Wort Friedrich Wilhelms III.« und »Preußen im Jahre 1845« – beide 1845. 1846 Urteil auf zweieinhalb Jahre Festung, 1847 Freispruch.
Okt.-Dez. 1849 Prozess in Königsberg wegen Teilnahme am Stuttgarter Rumpfparlament, Flucht nach Genf, eineinhalb Monate Haft in Königsberg, Freispruch im Dezember 1849; danach Polizeiaufsicht.
1863-65 Prozess wegen Ehrfurchtsverletzung gegenüber dem König, Aufruf zum Ungehorsam gegen die Steuergesetze und Beleidigung des Staatsministeriums. Grund ist eine Rede von 1863. 1864 Urteil auf sechs Monate Gefängnis. Abbüßung im Königsberger Stadtgefängnis.
danach:
1865: 50 Taler Geldstrafe wegen verleumderischer Beleidigung Bismarcks.
1865: Vierzehn Tage Gefängnis wegen Beamten- und Behördenbeleidigung.
1870: fünf Wochen Festungshaft wegen Protests gegen die Annexion Elsaß-Lothringens.
Das alles ist natürlich spektakulär und gewiss hat Jacoby mit seinen demonstrativ öffentlichen Provokationen zumindest bis 1849 auch die Öffentlichkeit als Schutz in Anspruch genommen – zum Schutz gegen rechtliche und obrigkeitsstaatliche Willkür. Aber ich denke, sein eigentliches Ziel war ein anderes, und vielleicht wird dies deutlicher, wenn ich die Episode hinzufüge, die Jacoby 1848 vollends zum Volkshelden machte, nachdem er der Obrigkeit bereits zweimal einen Freispruch abgetrotzt hatte.
Eine Deputation der preußischen Nationalversammlung, der Jacoby angehörte, wollte dem preußischen König – es ist natürlich immer noch Friedrich Wilhelm IV. – im November 1848, also mitten im Revolutionsgeschehen, eine Note überreichen, um ihn zu einer Regierungsumbildung zu drängen. Der König las kurz die Adresse und wandte sich dann bereits zum Gehen. Jacoby redete ihn an: „Wollen Ew. Maj. uns nicht weiteres Gehör schenken?“ Der König: ‚Nein’, darauf Jacoby: „Das eben ist das Unglück der Könige, dass sie die Wahrheit nicht hören wollen!“ Mehrere Kollegen bezichtigen ihn empört der Respektlosigkeit, doch wenige Tage später versammeln sich Tausende vor der preußischen Nationalversammlung (in der Berliner Taubenstraße) und feiern Jacoby.
Respektlosigkeit? Oder nicht einfach ein Verhalten ‚auf Augenhöhe’? Darin – so meine These – wird der moralische Kern des politischen Agierens von Johann Jacoby erkennbar: Jacoby stellte sich mit einer – buchstäblich – entwaffnenden Selbstverständlichkeit den so genannten Mächtigen als ein faktisch Gleicher gegenüber.
Aber nicht er erklomm dabei die Höhe der Macht (die es für ihn nicht gibt), sondern er sprach die Macht auf seiner, Jacobys Augenhöhe an – eine Haltung, die eine gewaltige Wirkung gehabt haben dürfte, nicht nur auf die Öffentlichkeit, sondern auch auf die Bürokratien, die nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten. Dafür zeugen Begriffe wie „Ehrfurchtsverletzung“, „frecher Tadel“, „öffentliche Beleidigung“ usw.
Ich will auch gleich auf den zweiten Teil meiner These zusteuern, denn hinter Jacobys – wie wir heute vielleicht sagen würden – ‚bürgerrechtlicher’ Haltung steht offenbar keine Aufklärungslehre oder irgendein philosophisch her- oder abgeleiteter Lehrsatz. Sein unmittelbares, eruptives Verständnis von Gleichheit und Gerechtigkeit ist eher und wohl vollständig geprägt von den Grundsätzen der jüdischen Sozialethik.
Lassen Sie mich an dieser Stelle zwei Bemerkungen einfügen. Jacoby gehörte der Konvergenz-Bewegung seiner Zeit an, gebildet von jungen christlichen Dissidenten und jungen liberalen Juden, die glaubten, die Zeit für die eine jüdisch-christliche Allianz auf Basis der gemeinsamen jüdischen Sozialethik sei gekommen. Jacoby erwartet wie viele andere, dass sich die Menschheit dereinst (eigentlich : sehr bald) in diesem reinen Deismus vereinigen wird, dass es aber – bis zu dessen „Allgemeinwerden“ – die „Bestimmung des Judaismus“ sein wird, „dem überhandnehmenden Gefühlsschwindel des Christentums auf alle mögliche Weise entgegenzuarbeiten“. Das sahen viele der kirchenkritischen christlichen Dissidenten übrigens auch so und es ist völlig in Vergessenheit geraten, dass diese städtische Bewegung – mit ihren Revolten gegen die Amtskirchen – auch die hauptsächlichen Träger der Revolution von 1848 war. Um dieser Bewegung willen, die gerade in Königsberg einen Schwerpunkt hatte, hat Jacoby eine allzu große Nähe zur Königsberger jüdischen Gemeinde vermieden – aber um so entschiedener die Grundsätze der jüdischen Sozialethik verfochten.
Zweitens: Die Revolution von 1848 scheiterte nicht nur am preußischen Machtwillen. Es gab auch eine tragische Bruchlinie innerhalb der Opposition selbst: Während die jüdische Seite hoffte, die christlichen Freunde hätten nun endlich das Andere am Judentum, die religiöse, fundamentale Bedeutung des Gleichheitsgrundsatzes nämlich, verstanden, bekämpften viele christliche Dissidenten nur ihre eigenen kirchlichen Institutionen, reflektierten aber nicht ihr loses Verhältnis zum Gleichheitsgrundsatz, z.B. ihre paternalistischen oder gar judenfeindlichen Attitüden. Die inhaltlichen, nicht nur religiösen Gründe, warum die jüdische Seite viele der christlich-metaphysischen Axiome ablehnte, wurden einfach überhört.
In der Tat durchzieht das Thema der Unvereinbarkeit zwischen der christlich-philosophisch-hellenistischen Metaphysik und der jüdischen Offenbarungslehre – und der unabsehbaren Folgen für die Ethik – wie ein Contrapunkt die gesamte deutsch-jüdische Publizistik des 19. Jahrhunderts.
Zusammengefasst sieht der Konflikt so aus:
Aus jüdischer Sicht ist schon im Schöpfungsakt des ersten Menschenpaares alles inbegriffen, es bedarf keiner weiteren Zutaten. Alle Menschen sind gleich, alle haben die individuelle Pflicht zur Nachahmung der göttlichen Vollkommenheit – zwischenmenschlich die Pflicht (nicht das Mitleid) dem Nächsten gegenüber, den Anderen gegenüber in Gesellschaft und Staat, und schließlich in der Menschheit allen Menschen gegenüber.
Wenn aber die Ethik – als Sozialbindung – von der Pflicht des Einzelnen her gedacht ist, so spielen sich auch die Kämpfe um die eigenen Grenzen, um das Böse, ausschließlich im Einzelnen ab. Das ist ganz wichtig, nicht nur hinsichtlich des jüdischen Ethos der Willensfreiheit.
Vielmehr kann es dann auch nicht – hier – die ganz guten und – dort – die ganz bösen Menschen geben, übrigens auch keine Kollektive (wie „der Staat“, die „Nation“ u. ä.), die ein ethisches Sonderrecht außerhalb des ethischen Pflichtenkanons des Einzelnen reklamieren könnten. Von daher fehlt z. B. nicht nur die Voraussetzung für rassistische, dualistische Argumentationen: Aus der Perspektive der jüdischen Sozialethik fällt es auch schwer, sich das Soziale in unveränderlichen Antagonismen, etwa als pure Gut/Böse-Zuordnungen zu denken oder auch – ich will es hier gleich nennen: von gottgewollten Lagern wie Kapital und Arbeit.
Die christlich-hellenistische Metaphysik rankt sich dagegen um die bis heute schwer begreifliche Anomalie, dass die christliche Bewegung die jüdische Ethik zwar in einer pastoralen Funktion übernahm, aber danach das genaue Gegenteil, den hellenistischen Idealismus und – seit Thomas von Aquin – besonders einen heidnischen Philosophen, nämlich Aristoteles, oben drauf setzte und dessen Anthropologie zum christlichen Dogma machte.
Wie bekannt, jonglierte dieser mit kruden Analogien: Stein, Pflanze, Tier und Mensch entsprächen im Menschen der Materie, dem Kreislauf, dem Nervensystem und dem Geist. Ergo sei der Mensch nur als Geist Mensch, ansonsten Tier, Pflanze und Materie. Aber dabei beließ es Aristoteles nicht und folgerte weiter: Menschen, die sich nicht – wie die Philosophen – im Geist erschöpften, könnten auf die Stufe der Tiere, ja der Pflanzen (wir kennen den Begriff: vegetieren) ‚herab sinken’. Es ist die Geburtsstunde der Barbaren, der Fremden, der menschlichen ‚Bestien’, des ‚animalischen’ Menschen, oder allgemein: der gut/böse-Antagonismen, der ‚guten’ und ‚bösen’ Kollektive, die später die Geistesgeschichte des Abendlandes so schrecklich prägen sollten.
Auch wenn die mittelalterliche Rezeption des Aristoteles – etwa bei Maimonides – auch auf jüdischer Seite Spuren hinterlassen hat, rief doch der jüdische Religionsphilosoph Jehuda Halevi etwa um 1100 aus: „Nicht ist der Gott des Aristoteles der Gott Abrahams“ – und mit ebenso gutem Grund heißt es bei einem der wichtigsten katholischen Dogmatiker der vergangenen Jahrzehnte: „Der Gott des Aristoteles und der Gott Jesu Christi ist ein und derselbe.“
Ich habe dies so pointiert dargestellt, weil Jacoby in seinem sogenannten ‚sozialen Bekenntnis’ diesen Konflikt frontal aufgreift. Es handelt sich um seine Rede Das Ziel der Arbeiterbewegung vom 20. Januar 1870. Im Rahmen unseres Forschungsprojekts, bei dem wir einige Hundert Schriften deutsch-jüdischer Publizisten analysierten, fiel uns diese Schrift besonders auf. Aber erst viel später wurde uns bekannt, dass diese Rede auch zu Jacobys Zeit besonderes Aufsehen erregte: Sie ist in viele Sprachen übersetzt worden und ist wohl der am häufigsten gedruckte Text Jacobys.
Jacoby beginnt mit dem denkwürdigen Hinweis, Aristoteles selbst habe die von ihm postulierte ‚Notwendigkeit’ des Barbaren- und Sklavenstandes ökonomisch begründet: Ohne dessen billige Arbeitsleistung wären nämlich die ‚Geist tragenden’ Schichten zur Arbeit, und das heißt: zur ‚Einschränkung ihres Menschseins’ gezwungen. Wie nun aber, so Jacoby weiter, wenn das von Aristoteles in einem Nebensatz ebenfalls Angedachte tatsächlich einträfe? Wenn ‚unbeseeltes Arbeitswerkzeug’ die Sklavenarbeit übernähme? Wäre dies nicht der Beginn einer Gesellschaft der Gleichen?
Jacoby muss nur auf seine eigene Zeit verweisen, um das Gegenteil zu konstatieren: Der technologische Fortschritt, mit dem Ziel der „unbeschränkten Herrschaft über die Natur“, hat die Ungleichheit verschärft und nun ein „Arbeiter-Proletariat“ geschaffen.
Es fällt uns heute – vor dem Hintergrund der ökologischen Debatte – leicht, Jacobys Kritik der Fortschrittsmentalität nachzuvollziehen, aber ich möchte zusätzlich darauf hinweisen, dass sich für Jacoby diese Mentalität fest an eine Ideologie der menschlichen Ungleichheit anlehnt. Fortschritt, das Signum der Moderne, ist danach programmatisch, und nicht beiläufig daran geknüpft, dass dafür Menschen zu opfern sind. Man denkt hier – nun schon vor dem Hintergrund der Shoah – an Horkheimer/Adorno’s Dialektik der Aufklärung oder an Zygmunt Baumans Fundamentalkritik der christlich-abendländischen Moderne.
Doch zurück zu Jacoby, der für seine Gegenwart zwei Möglichkeiten an die Wand malt: Entweder werde sich das Massenelend durch den vieltausendfachen Hungertod von selbst erledigen, oder eine gewaltsame ‚Umkehr’ der Verhältnisse wird heraufbeschworen, d. h. die Fortsetzung des Machtspiels, nun eben mit umgekehrten Vorzeichen. Die Französische Revolution habe zwar, was niemand rückgängig machen wolle, die rechtliche Freiheit der Individuen und des Kapitals proklamiert, aber die kulturell überkommene Logik der sozialen Ungleichheit nicht angetastet.
Wie also kann auf friedlichem Weg die gerechte Verteilung des Volkseinkommens erreicht werden? Für Jacoby lautet das Mittel: Abschaffung des Lohnsystems und Übergang zur freien gleichberechtigten Genossenschaftsarbeit, übrigens durch „einmütiges Zusammenwirken aller dabei beteiligten sozialen Kräfte“, der Arbeiter, der Arbeitgeber und des Staates. Jacoby erwähnt – als Forderungen – eine ganze Reihe der uns heute vertrauten Institutionen der Mitbestimmung, der Gewinnbeteiligung der Arbeitnehmer und des Sozialstaats. Doch insgesamt geht er – ich deute das nur an – darüber weit hinaus. Man denkt an die Sozialmodelle des Zionismus, etwa an die Kibbuz-Bewegung.
Aber wie möchte Jacoby die Bastionen der Macht, die Unternehmer und den Staat, die in Preußen noch durch eine protestantische Staatskirche umklammert sind, zur Abgabe ihrer Macht bewegen? Was hat denn die breite Bevölkerung – von der Revolution abgesehen – selbst in der Hand?
Gegen Ende seiner Rede nennt Jacoby „Bildung und Unterricht“ als jenes Mittel, über welches sich das Volk selbstständig Macht aneignen könne. Wie aber verkauft man etwas derart Subversives den preußischen Machteliten? Jacoby verfällt auf das wahrhaftig abenteuerliche Versprechen, „auch der Krieger“ werde schließlich durch Bildung „geschickter zu seinem Werke“. „Ein Unterrichtsminister, der sein Handwerk versteht, – so heißt es weiter – ist zugleich der beste Kriegs- und Finanzminister.“ Doch Jacoby ist nicht gerade ein Meister der Überredung und vielleicht war auch Sarkasmus im Spiel. Gerade hatte er nämlich – nach Garibaldis Vorbild – den Ersatz der Soldatenheere durch ein Volksheer und dann die Halbierung der Rüstungsausgaben gefordert, übrigens zugunsten von Bildung und Unterricht. Und am Schluss der Rede geißelt er auch noch die „Blut- und Eisenpolitik“ Bismarcks und den „Waffenlärm unserer Tage“. Die Bildung, die eine solche Kritik hervorbringt, taugt nicht zum Militarismus – im Gegenteil, Jacoby fordert eine kritische, und man darf ergänzen: auch sprachkritische Bildung, die sich politisch einbringen soll.
Eine Kultur der Bildung von unten, eine kritische Breitenbildung ist daher notwendige Voraussetzung für soziale Gleichheit und ökonomische Gerechtigkeit. Jeder, der darin groß wird, – so mag Jacobys Hoffnung sein – wird später illegitime Hierarchien bekämpfen und keine Korruption mehr dulden, sei er dann auch selbst Staatsmann oder Unternehmer. Vor allem aber bringt kritische Bildung jene selbstbewussten Bürger hervor, die Jacoby so sehr herbeisehnte.
„Das Volk muss bereit sein, selbst einzustehen für sein gutes Recht!“ – ruft er im November 1863 aus: „Nicht Revolution, nicht der redlichste Wille freisinniger Fürsten, kann einem Volk die Freiheit geben, ebenso wenig die Weisheit von Staatsmännern und Parlamentariern. Selbst denken, selbst handeln, selbst arbeiten muss das Volk, um eine papierne Verfassungsurkunde zu einer lebendigen Verfassungswahrheit zu machen.“
Diese kurze Skizze zur Rede Jacobys muss bereits genügen. Ich möchte abschließend versuchen, die Grundsätze Jacobys noch stärker herauszustellen, um dann Jacobys Beitritt zur Sozialdemokratie und um noch einen übergeordneten Aspekt zu streifen.
Doch dies geht nicht, ohne zuvor Jacobys unglaubliche Zivilcourage – und übrigens auch seine außerordentliche physische Kraft – zu erwähnen: Welche personale Stärke muss er aufgebracht haben, als er seine Positionen – oft ganz allein – der gewaltorientierten und mit ethischen Doppelstandards jonglierenden Realpolitik Bismarcks entgegenhielt, als er – letztlich völlig ungeschützt – als dessen Gegenspieler auftrat? Jacoby vertrat die Anschauung vom einen, unteilbaren Ethos mit gutem Grund. Er durchschaute Bismarcks Prinzip des gespaltenen Ethos: für drinnen, für die aristokratische wie bürgerliche Idylle der puritanische Rigorismus, für draußen die Vernichtungsmentalität des Krieges. Diese ethische Lebenslüge musste früher oder später zum inneren Zusammenbruch führen. Und wer die unteilbare Ethik fordert, verurteilt den Krieg.
Jacobys scharfe Kommentare füllen ein ganzes Buch: Bismarck’s „verwerfliches Regierungssystem“ erschüttere „die rechtlichen und sittlichen Grundlagen des Staats auf’s Tiefste“, heißt es 1865. Das „eines selbstbewussten Volks unwürdige System bureaukratischer Bevormundung“ Bismarcks geißelt er 1869. Und nach dem Feldzug gegen Frankreich, entgegen der propagandistisch inszenierten nationalen Euphorie, meint er, es sei „der barste politische Unverstand, zu glauben, aus Unrecht und Gewalttat könne den Völkern irgend ein Heil erwachsen.“
Solche Aussagen bedeuteten fast immer Anklagen, Hausdurchsuchungen oder gar Haft. Dass Bismarck Jacoby als Gegner ernst nahm, war nicht wirklich ein Trost: Viele Bekannte und gar die engste Freundin Jacobys, Fanny Lewald, erlagen Bismarcks Kraftmeierei und verurteilten Jacobys Rigorosität – wie übrigens auch Karl Marx. Die Geschichte der erbitterten Auseinandersetzung Jacobys mit Bismarck ist atemberaubend.
Doch nun zu den Grundsätzen. Im Zentrum steht eine von unten gedachte Rechts- und Sozialordnung, deren ethische Maximen unteilbar sind und die im Kleinen wie im Großen gelten. Ziel des Handelns ist die gerechte Gesellschaft, die mit dem Recht des Einzelnen stets vereinbar ist. „Im Namen der Kirche! Im Namen des Staates! Im Namen der Gesellschaft!“, so Jacoby, dürfe niemand entrechtet oder der Herrschaft anderer unterworfen werden. Umgekehrt sind die Interessen im Kleinen, etwa in der Familie, wichtig, aber das Ethos der Gerechtigkeit endet dort nicht: Auch die Nebenmenschen, die größere Gemeinschaft müssen in ihren Ansprüchen auf Gerechtigkeit berücksichtigt werden. Die Nation ist wichtig, aber sie darf niemals dem noch höheren Ziel – der gerechten Menschheit – zuwiderlaufen – usw. usw.
Zu beachten ist auch: Ein Rechts- und Sozialstaat, der – wie ihn Jacoby fordert – genossenschaftlich von unten aufgebaut und getragen wird, ist kein obrigkeitsstaatlich verwalteter Wohlfahrtsstaat, wie ihn Bismarck einführte. Er basiert vielmehr auf dem Ethos individueller Pflichten, auf der aufmerksamen, sozialen Subsidiarität in der ganzen Breite der Gesellschaft.
Einen zweiten Aspekt hatte ich bereits angedeutet: Wie viele andere deutsch-jüdische Publizisten, etwa Gabriel Riesser oder Ludwig Philippson, konnte Jacoby das Soziale nicht getrennt vom Recht, d. h. vom Grundsatz „Gleiches Recht für Alle“ denken, auch nicht in unveränderlichen Gut/Böse-Antagonismen wie Klassen oder wie Kapital und Arbeit. Und das führt ihn – wie wir schon hörten – zur tiefen Skepsis gegenüber gewaltsamen Umwälzungen und Freund-Feind-Doktrinen. Dies zeigen nicht zuletzt die Meinungskämpfe in den internationalen Organisationen, denen Jacoby in den 60er und 70er Jahren angehörte.
Er hat im Verlauf seines politischen Lebens die Gewichte durchaus unterschiedlich gesetzt. Doch ab Mitte der 60er Jahre, so wird allgemein berichtet, näherte er sich sozialistischen, bzw. sozialdemokratischen Positionen. Seine Vorliebe wäre zwar eine umfassendere radikaldemokratische Bewegung gewesen, aber sie gab es nicht und sie selbst zu gründen, gelang Jacoby trotz einiger Anläufe nicht. Es war deshalb sehr typisch, dass er in jenem Moment öffentlich der Sozialdemokratie beitrat, in dem auch deren Führer, Bebel und Liebknecht, wie zuvor Jacoby selbst, durch den Bismarck’schen Verfolgungsapparat in die Rolle der Bürgerrechtler gedrängt wurden und vor dem Richter landeten. Jacoby stellte sich bis zu seinem Tod der Sozialdemokratie in vielfältiger Weise bei Wahlen zur Verfügung, und wirkte umgekehrt – sozusagen als elder statesman – in die junge Sozialdemokratie hinein. Eine bedeutsame Führungsrolle, die ihm oft möglich gewesen wäre, umging er immer wieder. Und dann folgt die Momentaufnahme, die ich Ihnen zu Beginn schilderte – am Grab.
Aber es fehlt noch etwas: Wenn es zutrifft, dass sich Jacoby in seiner unbedingten Vorstellung von sozialer und rechtlicher Gleichheit auf die reiche Tradition der jüdischen Sozialethik stützt, ist dies dann nicht eine religiöse Haltung? Tatsächlich unterstreichen viele andere deutsch-jüdische Autoren des 19. Jahrhunderts, dass Judentum und die Vision der gerechten Gesellschaft, d. h. die individuelle Pflicht zur Gerechtigkeit, eigentlich ein und dasselbe seien, dass Religion in diesem Ethos (und in nichts sonst) ihre Bestimmung habe. Johann Jacoby hat sich dazu bekannt, als er seine Schwester bat, sich um ein religiöses Begräbnis für ihn zu kümmern.