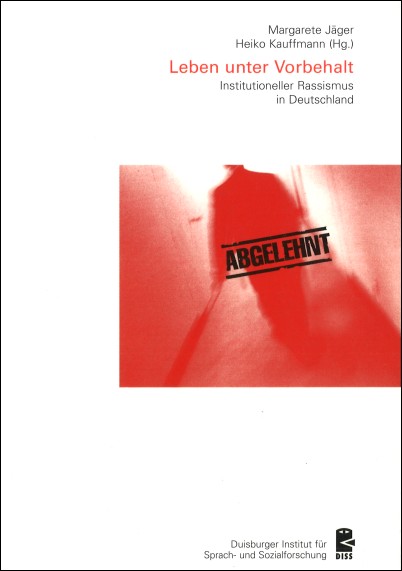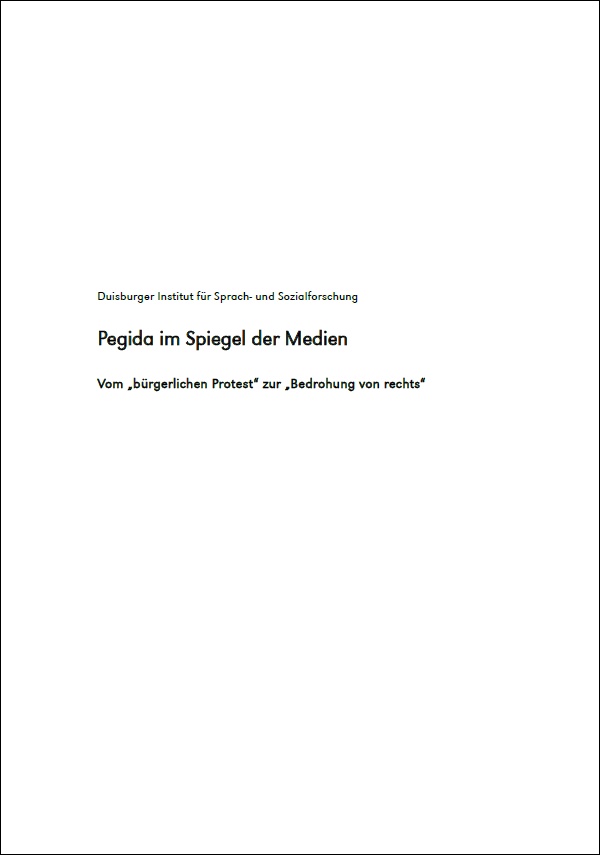Vor 25 Jahren: Der Brandanschlag in Solingen.
Der V-Mann und die Neonazis
Von Anton Maegerle
Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mölln, Hünxe, Solingen – in einer Serie von Anschlägen gegen AusländerInnen und AsylbewerberInnen zu Beginn der 90er Jahre wurde die Stadt im Bergischen Land zum Tatort. Der Bundestag hatte im Mai 1993 nach jahrelangem Streit eine Verschärfung des Asylrechts beschlossen. Drei Tage später schlugen die fremdenfeindlichen Mörder in Solingen zu.
In der Nacht zum 29. Mai 1993, gegen 01.49 Uhr, verübten Neonazis einen Brandanschlag auf das Wohnhaus der türkischen Familie Genc, die vor 23 Jahren in die Bundesrepublik gekommen war. In deren Haus in der Unteren Wernerstraße 81 in Solingen starben fünf Frauen und Kinder: Gülüstan Öztürk (12) und Gürsün Ince (27) sowie Saime Genc (4), Hülya Genc (9) und Hatice Genc (18). Gut sechs Monate zuvor starben bei einem ebenfalls fremdenfeindlich motivierten Anschlag im schleswig-holsteinischen Mölln die Türkinnen Bahide Arslan (51), Ayse Yilmaz (14) und Yeliz Arslan (10).
Als im Mai 2008 an den tödlichen Brandanschlag von Solingen vor 15 Jahren erinnert wurde, sagte der damalige NRW-Integrationsminister und heutige NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU): „Wir erinnern an diese Mordtat, weil sie nicht vergessen werden darf. Der Brandanschlag von Solingen war der schlimmste fremdenfeindliche Anschlag in der Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalen“. Daran hat sich bis heute nichts geändert.
Drei der Solinger Attentäter gingen in der Kampfsportschule „Hak Pao“ (Schwarzer Panther) von Bernd Schmitt (Jg. 1944), einem Fachmann für den Kampf Mann gegen Mann, ein und aus. Nach dem Anschlag wurden zentnerweise Unterlagen aus der Solinger Kampfsportschule geschleppt und in einen Mercedes-Lieferwagen gepackt. Der Wagen wurde von der Polizei zwar gestoppt, durfte dann aber weiterfahren. Erst einen Monat später wurde das geheime Archiv der „Hak Pao“, 55.000 Blatt, gehoben. Dabei stießen die Ermittler auf Lageskizzen von Wohnungen ausländischer Bürger und Anleitungen zum Bau von Molotow Cocktails.
Im Juni 1994, dreizehn Monate nach dem Brandanschlag in Solingen, wurde Bernd Schmitt als V-Mann enttarnt. Schmitt war nach offizieller Darstellung seit dem 3. April 1992 als V-Mann für das Landesamt für Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen im Einsatz. Zuvor war er ab dem 25. März Gelegenheitsinformant.
Der diplomierte Sportlehrer war Inhaber der 1987 gegründeten Kampfsportschule „Hak Pao“ mit Sitz in der Straße In der Freiheit 22 in Solingen. Vor Ort betrieb Schmitt einen „Deutschen Hochleistungs-Kampfkunstverband“ (DHKKV), eine Vorfeldorganisation der bundesweit aktiven Neonazi-Truppe „Nationalistische Front“ (NF). Die NF und deren Planungen zum Aufbau eines militanten „Nationalen Einsatzkommandos“ (NEK) waren Zielobjekte des V-Mannes. Die 1985 gegründete NF wurde zwar im November 1992 vom Bundesminister des Innern wegen Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus als verfassungswidrige Organisation verboten, führte ihre Untergrundstrukturen nach dem Verbot jedoch weiter. Führer der NF vor und nach dem Verbot war der Neonazi Meinolf Schönborn. Schönborn referierte selbst am 7. März 1992 in den mit einem Hakenkreuz geschmückten Räumen von „Hak Pao“ über „nationale Fragen“.
Förderer des DHKKV war der Altnazi Otto-Ernst Remer. Remer war Kommandeur beim Wachbataillon „Großdeutschland“, das den Aufstand gegen Hitler am 20. Juli 1944 blutig niederschlug. In einem Werbeflugblatt des DHKKV hieß es: „Leider sind die meisten Deutschen zu bequem geworden, sich einem intensiven sportlichen Training zu unterziehen. In den meisten Clubs und Schulen in Deutschland liegt der Ausländeranteil bei über 80%. Sollte dies nicht zu denken geben? Wir wollen keine Schläger ausbilden, aber hart trainieren“. Beim DHKKV ließen sich Neonazis beim „kanackenfreien Training“ für den Straßenkampf schulen. Nach erfolgreichem Training fungierten die ausgebildeten Schläger als Ordner und Personenschützer bei Neonazi-Veranstaltungen. So bewachte Schmitt mit acht kampferprobten Kameraden den damals international bekannten und eigens aus Kanada angereisten deutschen Holocaustleugner Ernst Zündel bei einer rechtsextremen Veranstaltung des „Förderkreises Freies Deutschland“ und des NF-Stützpunktes Rhein-Sieg am 5. Juni 1992 in Bonn. In einem Veranstaltungsbericht der Organisatoren wird der DHKKV für sein Auftreten bei der Zündel-Veranstaltung gelobt: „Jeder von ihnen ist ein Meister seines Faches. Ihr diszipliniertes … Auftreten imponierte so manchen. Auch an sie ein dickes Dankeschön, die sie ihre Kampfkunst und auch Gesundheit im Ernstfall, der zum Glück nicht eintraf, selbstlos zum Einsatz gebracht hätten.“
Im direkten Umfeld des DHKKV existierte noch eine weitere braune Handkantentruppe: die „Deutsche Kampfsportinitiative“ (DKI). Bei dieser arbeitete Schmitt als Trainer. Die DKI verstand sich als „Zusammenschluss patriotisch denkender Kampfsportler, die es sich zum Ziel gesetzt haben, den Sport bzw. Kampfkünste im Nationalen Lager bundesweit zu fördern“. Werbeanzeigen der DKI wurden unter anderem im NPD-Bundesorgan „Deutsche Stimme“ oder der „Deutschen Rundschau“, dem Sprachrohr der NPD-Abspaltung „Deutsche Liga für Volk und Heimat“ (DLVH), platziert. Für einen DKI-Lehrgang am 5. Juni 1993 war neben dem bis heute bundesweit bekannten Neonazi Christian Worch auch Markus G. vorgemerkt. Zum Termin des Lehrgangs konnte dieser nicht erscheinen, da er kurz zuvor wegen Beteiligung an dem Solinger Brandanschlag festgenommen worden war.
Der damalige Innenminister Herbert Schnoor (SPD) erklärte nach dem Outing des Spitzels, dass Schmitt „sein Vorgehen immer mit dem Verfassungsschutz abgestimmt“ hat. Dem Verfassungsschutz habe Schmidt den Namen eines der Attentäters des Brandanschlags geliefert. Auch soll mit Schmitts Hilfe ein Anschlag von Skinheads auf ein Asylbewerberheim verhindert werden worden sein, so Schnoor. Andererseits musste der Minister eingestehen, dass V-Mann Schmitt einige Mitglieder von „Hak Pao“ nach dem Brandanschlag vor Hausdurchsuchungen gewarnt hatte. Seine V-Mann-Dienste soll Schmidt aus finanziellen Interessen geleistet haben. Die Bezüge verglich Schnoor mit dem Lohn eines „Arbeiters, der am Hochofen steht“.
Der 6. Strafsenat des Oberlandesgerichtes Düsseldorf hat am 13. Oktober 1995 alle vier Angeklagten des Solinger Brandanschlags wegen Mordes an fünf Menschen, wegen versuchten Mordes an 14 Menschen und wegen besonders schwerer Brandstiftung verurteilt. Die Attentäter sind heute wieder auf freiem Fuß. Das ausgebrannte Haus der Familie Genc wurde im August 1993 abgerissen.
Einer der vier Brandstifter war im September 2005 vom Landgericht Dortmund zu einer Haftstrafe von vier Monaten ohne Bewährung verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Christian R. bei einer Neonazi-Demonstration in Hamm zweimal den Hitlergruß gezeigt hatte.
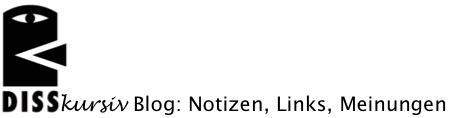


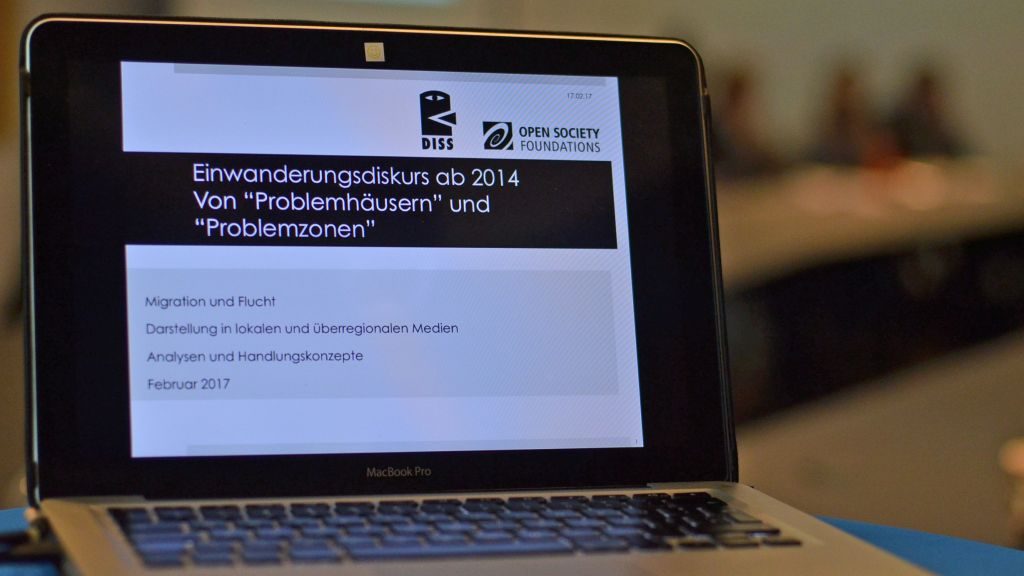
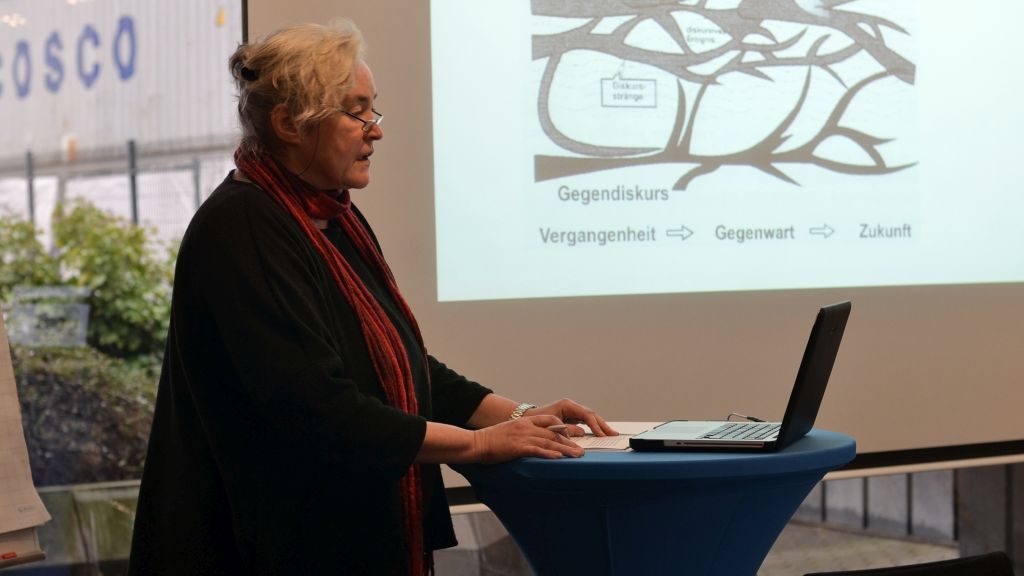
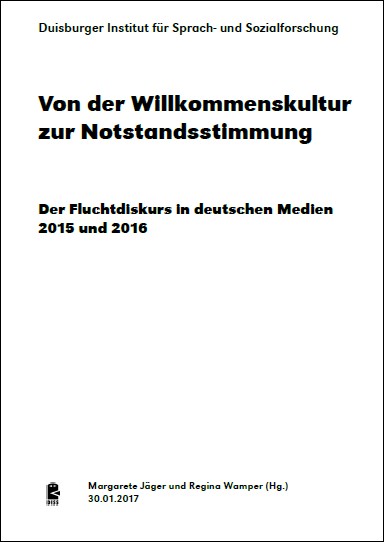 Margarete Jäger und Regina Wamper (Hg.)
Margarete Jäger und Regina Wamper (Hg.)