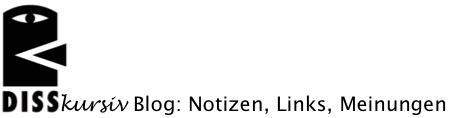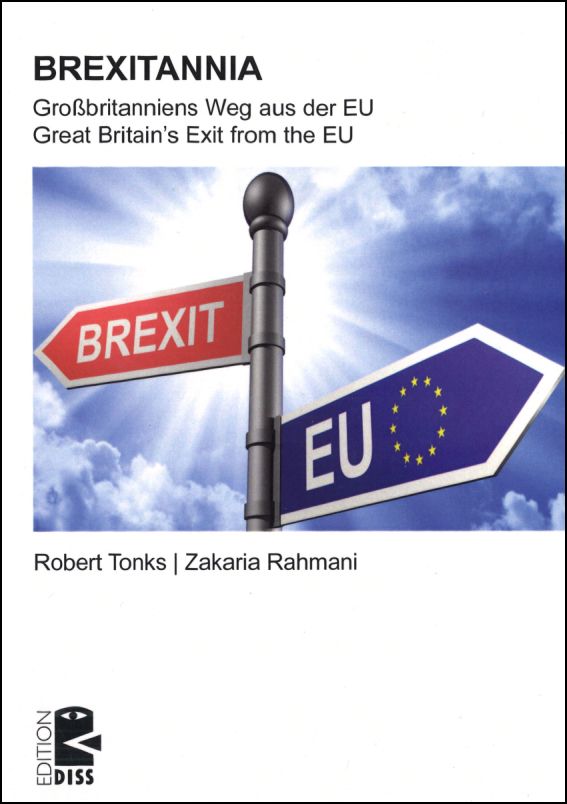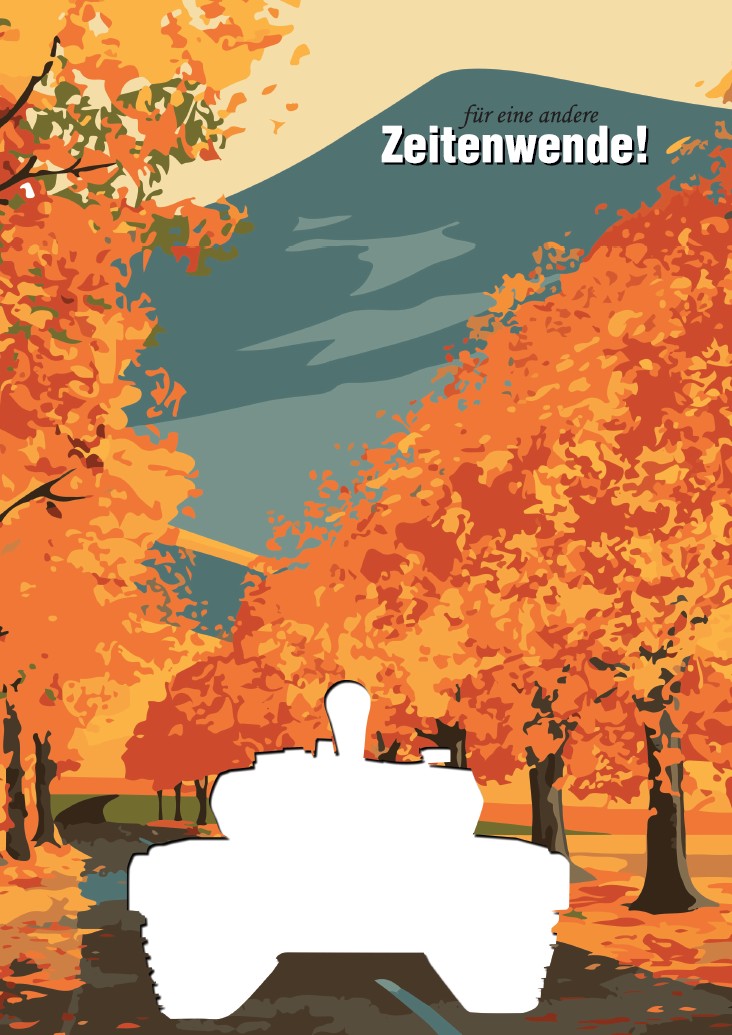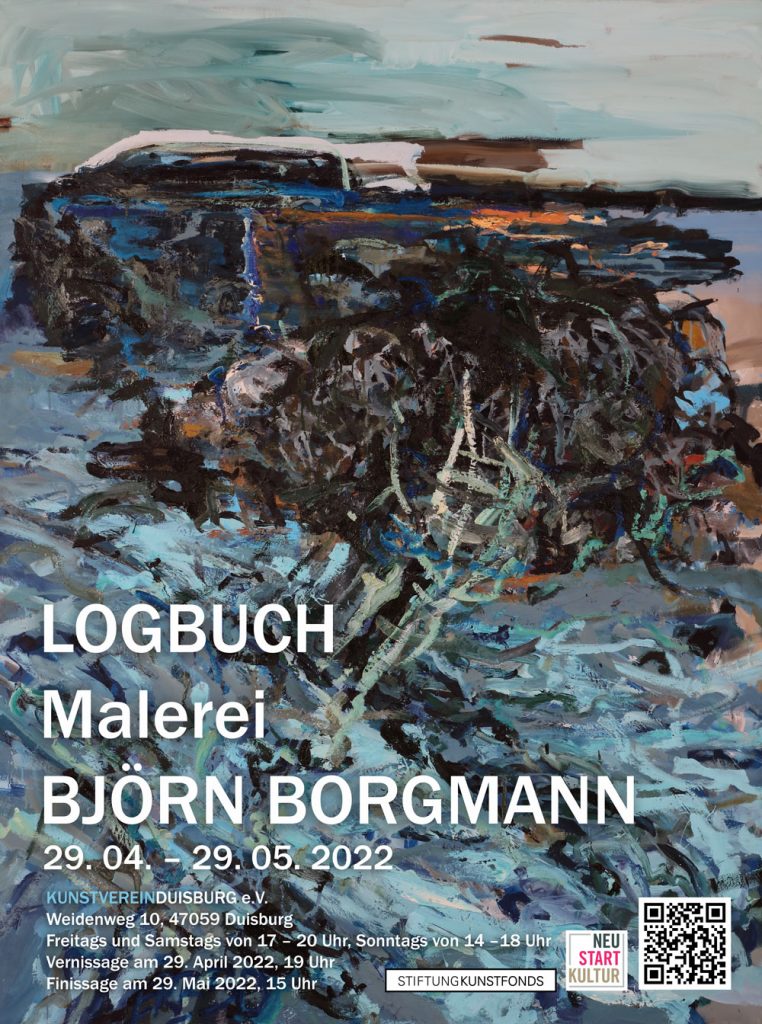Robert Tonks & Zakaria Rahmani:
Brexitannia
Edition DISS Bd. 49
1. Auflage, Oktober 2022
ISBN 978-3-89771-778-7
UNRAST Verlag, Münster
Bestellungen bitte über den Unrast-Verlag: BREXITANNIA
Im Jahr 1973 trat Großbritannien der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) bei. In einem Referendum zwei Jahre später stimmten 68% der Brit*innen für den Verbleib in der EWG. Am 31. Januar 2020 trat Großbritannien schließlich aus der Europäischen Union (EU) aus. Was war in der Zwischenzeit passiert?
Um die britische Sicht der Dinge zu verstehen, reisten die Autoren – der deutsch-britische Politikwissenschaftler Robert Tonks und der Medienproduzent Zakaria Rahmani – im Sommer 2020 quer über die Insel. Aus ihren Recherchen entstand der WDR-Podcast Brexitannia, der inzwischen sogar im Schulunterricht verwendet wird. Tonks und Rahmani sprachen mit zahlreichen Menschen aus unterschiedlichsten Lebensbereichen, Schichten und Berufen und mit dem Professor, der als ‚Erfinder des Brexit‘ gilt.
Jetzt liegt dieser aufschlussreiche Podcast endlich auch als Buch vor.
Teil I
BREXITANNIA
Großbritanniens Weg aus der EU
Vorwort
Erstes Kapitel
Der Feind im Inneren
Zweites Kapitel
Auf der Suche nach ‚Middle England‘
Drittes Kapitel
God save the NHS
Viertes Kapitel
Rule Britannia!
Epilog: Den Brexit ‚einfach‘ umsetzen – oder auch nicht…
Der aktuelle Stand am 7. Juli 2022
Part II
BREXITANNIA
Great Britain’s Exit from the EU
Preface
First Chapter
The Enemy Within
Second Chapter
In Search Of Middle England
Third Chapter
God Save The NHS
Fourth Chapter
Rule Britannia!
Epilogue: Simply Getting Brexit Done – Or Not
The State of Affairs on 7 July 2022
Das vorliegende Buch basiert auf der Feature-Reihe als Audio-Podcast Brexi-tannia – Großbritanniens Weg aus der EU in der WDR 5-Serie Tiefenblick im Westdeutschen Rundfunk. Ausgestrahlt wurde die Reihe in vier Folgen zwischen dem 6. und 27. Dezember 2020.
Die Reihe ist abrufbar unter folgendem Link:
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-tiefenblick/audio-brexitannia–der-feind-im-inneren-100.html
Die Feature-Reihe dokumentiert, wie ein Deutsch-Brite nach den Wahlmotiven der Britinnen und Briten sucht, die am 23. Juni 2016 für den Brexit gestimmt haben.
Wie konnte es so weit kommen? Dieser Frage gingen Robert Tonks, diplomierter Politikwissenschaftler und engagierter Europäer, und der Medienproduzent Zakaria Rahmani bei einer Rundreise durch Großbritannien Mitte 2020 nach. Sie führten ausführliche Interviews mit Menschen aus verschiedenen Lebenslagen und mit Expertinnen durch.
Daraus ist ein Tiefenblick in die letzten Jahrzehnte europäisch-britischer Beziehungen entstanden.
Während der Audio-Podcast im Original auf Deutsch veröffentlicht wurde, erscheint das Buch nun auf Deutsch und Englisch.
Der Abdruck der Texte erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Westdeutschen Rundfunks. Die geschriebenen Texte basieren auf Transkriptionen und Übersetzungen der gesprochenen Originaltexte durch die Autoren.
Die Autoren danken dem WDR – und insbesondere der WDR-Redakteurin Leslie Rosin – für die Unterstützung bei der Produktion des Podcasts.
Die Autoren danken Iris Tonks für die Unterstützung bei der Produktion des Podcasts.