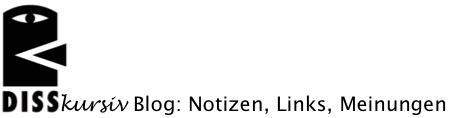Ökonomie und Minderheiten-bashing zum 20. Jahrestag der Einheit
Autor: Jobst Paul
In seiner Ansprache zum 3. Oktober 2010 ließ Bundespräsident Wulff den rassistisch-biologistischen Tenor der Sarrazin-Debatte unkommentiert und übernahm stattdessen deren ‚ordnungspolitischen’ Reduktionismus. So, als habe die Einwanderung in die BRD gerade erst begonnen und als seien nicht bereits ganze Generationen von Einwanderern deutsche Staatsbürger, forderte Wulff die Beachtung von deutschem „Recht und Gesetz“, von „unsrere(n) gemeinsamen Regeln“ und das Akzeptieren von „unsere(r) Art zu leben“. In einem polemischen Schwenk gegen „multikulturelle Illusionen“ setzte er hinzu, diese hätten bei Einwanderern stets zum „Verharren in Staatshilfe, Kriminalitätsraten, Machogehabe, Bildungs- und Leistungsverweigerung“ geführt.
Bereits tags zuvor hatte der ehemalige rotgrüne Präsidentschaftskandidat Joachim Gauck im Berliner Abgeordnetenhaus – aus ‚christlicher Fürsorge’, wie er andeutete – die Gruppe der ‚integrationsunwilligen Ausländer’ mit Forderungen und Drohungen bedacht. Überrascht meldete daher die Neue Zürcher Zeitung aus Berlin „eine ganz neue Tonlage“ (4. Oktober 2010, Titel) und die Wiederaufnahme der deutschen ‚Leitkultur’-Rhetorik, nun als Haltung aller politischer Lager: Wulff und Gauck hätten „an diesem historischen Tag“ eine Tonlage aufgenommen, „die ziemlich genau zwei Wochen nach der ersten Welle der Empörung über Sarrazin aufkam und sich derzeit immer deutlicher in nahezu allen Lagern durchsetzt.“
Auch wenn die NZZ Wulffs Wendung „deutsch lernen“ als „deutsch leben“ missverstand (ein seltener Lapsus des Blatts), kommentierte sie doch plausibel, der Präsident habe – gemeinsam mit Merkel und Gabriel, „wenn nicht explizit, so doch in der Stossrichtung letztlich nur das Postulat von der Leitkultur“ wiederholt, „mit dem sich 2000 der damalige CDU-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Friedrich Merz, noch entsetzte Kritik eingehandelt hatte.“
Ofenbar hat die Berliner politische Mitte in einem gemeinsamen rechten Manöver ihre Definitionsmacht gegen außerparlamentarische Konkurrenten wie Thilo Sarrazin und Alice Schwarzer wieder durchgesetzt. Um „den oft feindliche(n), ausgrenzende(n) Duktus“ Sarrazins (NZZ) einzufangen, bietet sie neue autoritäre Maximen gegenüber Minderheiten auf. Und: In verblüffender Einmütigkeit erwähnten weder Gauck noch Wulff als Bezugspunkt das Grundgesetz oder die deutsche Geschichte vor 1989.
All dies liefert genug Grund (nun allerdings auch mehr Transparenz), eine Analyse zu wagen, in die zumindest drei weitere Aussagen der Akteure eingehen sollten. So bezeichnete Gauck nicht nur (erstens) die ins Visier genommene Minderheit als „Abgehängte“, die einer „selbst gewählten Ohnmacht“ erlegen seien, also als Handelnde gelten müssen. Er fasst in dieser Minderheit auch (zweitens) „integrationsunwillige Ausländer“ und die „Empfänger von Hartz-IV Arbeitslosengeldern“ zusammen. Drittens schreiben sowohl Wulff wie Gauck der neu erfundenen Minderheit potenziell eine gegen die bestehende Gesellschaft gerichtete Militanz zu. Während Wulff bei ihr Verachtung für „unser Land und seine Werte“ vermutet und „mit entschlossener Gegenwehr“ droht, ruft Gauck den Staat auf, den „merkwürdigen Zustand“ zu beenden, dass jene, „die die deutsche Kultur ablehnten, sie sogar bekämpften und denunzierten“, trotzdem vom Staat versorgt sein wollten. Wulff sprach ebenfalls von „durchaus notwendigen Debatten“, machte als Feinde jedoch bereits „fundamentalistische“, bzw. „rechte oder linke Extremisten“ dingfest.
Angesichts dieses Bedrohungsszenarios wirkt das Arsenal der Gegenmittel, das nicht nur Wulff und Gauck in Position bringen, allerdings ernüchternd: Es ist hauptsächlich der Besuch von Deutschkursen, an den die Auszahlung von Geldern geknüpft werden könnte, bzw. die Ahndung von Bildungsunwilligkeit, wie Wulff mit Bezug auf Aussagen der Berliner Jugendrichterin Kirsten Heisig sagte. Ob allerdings hier das Nahziel des großen rhetorischen Aufwands liegt, ist zweifelhaft.
Mehr Sinn macht die Vermutung, dass vorläufig die Bestimmung einer flexibel deutbaren ethno-sozialen Minderheit wichtiger zu sein scheint, die künftig im öffentlichen Diskurs mit hohem politischen Segen mit rassistischem wie sozialdarwinistischem Unterton charakterisiert oder gar mit ‚terroristisch’-fundamentalistischen Motiven belegt werden darf. Dann aber hat sich der „feindliche, ausgrenzende Duktus“ Sarrazins ein Gutstück der Mitte einverleibt, und dass es keine ‚nur’ rhetorische Ausgrenzung gibt, wird auch Wulff und Gauck bekannt sein.
Lässt man im übrigen die überwunden geglaubte Kategorie des ‚Asozialen’ einmal beiseite, so erinnert das Etikett der ‚Integrationsunwilligen’, die der Gesellschaft feindlich gegenüber stehen, an die Klasse, die schon die Politologie des Altertums als die ‚gesetzlosen Außenseiter’ beschrieb, die zu den Waffen greifen ((Aristoteles, Politik, Buch I, Kapitel 2.)) und denen kein staatsbürgerlicher Status zusteht.
Doch die „Abgehängten“ bildeten nur das eine Ende der Festtagsrhetorik zum 20. Jahrestag der Deutschen Einheit. Am anderen Pol standen insbesondere bei Wulff überraschenderweise völlig andere staatsmännische Überlegungen. Gegen „Legendenbildungen, Zementierung von Vorurteilen und Ausgrenzungen“ vorzugehen, sei im nationalen deutschen Interesse. Die Zukunft gehöre Nationen, „die offen sind für kulturelle Vielfalt, für neue Ideen und für die Auseinandersetzung mit Fremden und Fremdem“. Im Wettbewerb mit aufstrebenden Ländern wie Indonesien, Brasilien, China, Russland oder Indien, müsse Deutschland „mit seinen Verbindungen in alle Welt offen sein gegenüber denen, die aus allen Teilen der Welt zu uns kommen“. Wulff krönte diese Rhetorik mit dem vielleicht erstmaligen Eingeständnis eines deutschen Bundespräsidenten, neben dem Christentum gehöre das Judentum „zweifelsfrei zu Deutschland“, aber der Islam gehöre inzwischen auch zu Deutschland.
Es gibt eigentlich nur eine einzige Möglichkeit, einen sinnvollen Zusammenhang zwischen diesen staatsmännischen und den zuvor gegen eine Minderheit gerichteten Aussagen herzustellen: Insbesondere Wulff stellte eine mögliche interkulturelle Orientierung Deutschlands nahezu ausschließlich in den utilitaristischen Kontext einer ökonomischen Staatsräson. Statt die reziproken Prozesse interkulturellen Austausches an sich und als produktiv und innovativ zu bejahen, interessierte sich der Bundespräsident für Interkulturalität letztlich nur als Teil des Images der deutschen Exportindustrie. Auch was die deutsche Kultur selbst – außerhalb ökonomischer Zwänge – sei und was sie ihrerseits in einen interkulturellen Austausch einbringen könnte, dazu konnte Wulff nichts sagen.
Wirtschaftliche Expansion ‚von Deutschland aus’, begleitet gar von militärischen Begleitmaßnahmen, kann allerdings tatsächlich nicht als interkulturelle Veranstaltung durchgehen. Umgekehrt aber scheint für Wulff hier der Kern „unsere(r) Art zu leben“ zu liegen. Die erfolgreiche Integration von ‚Migranten’ läge dann in deren ‚Beitritt’ und Bekenntnis zum ökonomischen und nur insofern nationalen Wir-Gefühl der Deutschen. Eine religiöse (und kulturelle) Zugehörigkeit, solange sie nicht ins ökonomische Glaubensbekenntnis hineinredet, darf dann offenbar gern ‚zu Deutschland gehören’.
Und doch bleibt das Szenario noch unvollständig: Zunächst haben Wulff, Gauck, Seehofer u. a. die Umrisse der ethno-sozialen Schicht der ‚Abgehängten’, die künftig mit hohem Segen ‚etwas’ rassistisch und sozialdarwinistisch diskreditiert werden dürfen, ohne Zweifel deutlich genug konturiert. Das Manöver wird allerdings erst ganz durchschaubar, wenn nicht nur jene, die abgewertet, sondern auch das politische Klientel, das Wir, betrachtet wird, um das Wulff, Gauck, Seehofer u. a. derzeit mit der politischen Rechten ringen – immerhin im Vorfeld der Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Rheinland- Pfalz im März 2011.
Um dieses Wir zu ermitteln, dessen Selbstwertgefühl gestärkt werden soll, genügt es, kurz die ethischen Nebenkosten der derzeitigen ökonomischen Staatsräson zu benennen, deren Verdrängung nicht weniger zur deutschen Identität der Gegenwart gehört. So dienten viele der internationalen ‚faulen’ Kredite, die die Weltwirtschafts- und Finanzkrise mit auslösten, dem Kauf deutscher Güter und damit der deutschen Exportindustrie, während die Kosten der Krise in Deutschland zum Gutteil dem Steuerzahler aufgebürdet wurden. Überwiegend mittlere Einkommensbezieher und ihre Familien, die ohnehin vom sozialen Abstieg bedroht sind, hat dies besonders aufgebracht. Als Mittel, sie nicht ans rechte Spektrum, vor allem aber nicht als willige Produktivkraft zu verlieren, scheint es probat, ihnen kräftige Feindbilder anzubieten – aber nicht nur: Ausgerechnet von marktliberaler Seite wird für sie nun eine Geldkompensation durch Lohnerhöhungen gefordert (Brüderle).
Das Klientel, das Wir, dessen Unmut derzeit offensichtlich kanalisiert werden muss, scheint jedoch umfangreicher: Mit dem Argument, Deutschland werde bald das Schlusslicht der Industriestaaten bilden, hatte Gerhard Schröder schon zuvor einen von Ausbeutung geprägten Niedriglohnsektor abgesteckt, der zwischenzeitlich in die soziale Konkurrenz mit den Empfängern staatlicher Transferleistungen manövriert worden ist. Die umfassende Durchsetzung von Mindestlöhnen könnte die Spannungen vielleicht mildern, aber nicht vergessen machen, auf wessen Kosten auch hier getrickst wurde. Es ging der deutschen Wirtschaft nicht um Chancengleichheit auf dem Weltmarkt: Der Niedriglohnsektor diente der deutschen Exportwirtschaft, wie heute sichtbar wird, der nachhaltigen Übertrumpfung ihrer internationalen Konkurrenz.
Dieser Artikel stammt aus der Ausgabe 20 des DISS-Journal, die im November 2010 erschien. Hier finden Sie das komplette DISS-Journal 20 als PDF-Datei.