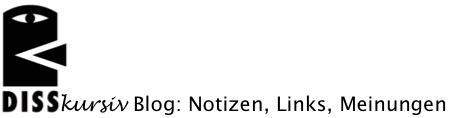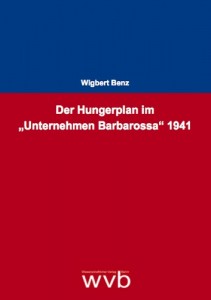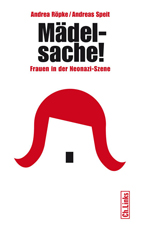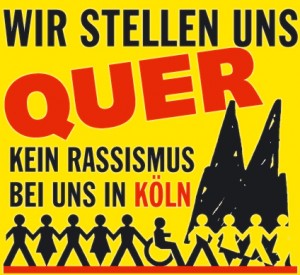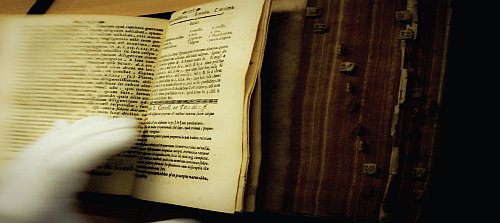In der aktuellen Ausgabe 89 (Juli 2011) der österreichischen jüdischen Kuturzeitschrift David erschien fogender Beitrag von DISS-Mitarbeiter Jens Zimmermann, der im Zusammenhang mit unserem Forschungsprojekt zur deutsch-jüdischen Publizistik des 19. Jahrhunderts entstand.
„Denn das Reich der Freiheit wird erstehen…“ –
Anmerkungen zur politischen Publizistik Leopold Zunz‘
Autor: Jens ZIMMERMANN
Das Emanzipations- und Glücksversprechen, das die bürgerliche Gesellschaft den Individuen in Aussicht gestellt hat, blieb im historischen Verlauf wirkmächtige Fiktion. Nichts gibt darüber mehr Auskunft als der von der deutschen Öffentlichkeit des 19. Jahrhunderts abgelehnte Versuch deutsch-jüdischer Autoren, in die politischen Debatten über Demokratie, Staatsbürgerschaft und Nationalbegriff publizistisch einzugreifen.1 Die an den eigenen Emanzipationswunsch geknüpfte Hoffnung deutscher Juden, einen eigenen Beitrag zur Konstitution eines republikanisch-demokratischen Deutschlands zu leisten2, wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts einerseits durch Ignoranz der politischen Öffentlichkeit, andererseits durch den virulenten Antisemitismus der Mehrheitsgesellschaft zunichte gemacht.
Trotz dieser Ablehnung konstituierte sich im Vor-Kaiserreich eine vitale und umfangreiche Publikationslandschaft deutsch-jüdischer Autoren, in welcher um Staatsbürgerschaft und demokratisch-rechtsstaatliche Ideen aus einer spezifisch deutsch-jüdischen Perspektive diskutiert und gestritten wurde. Leopold Zunz (1794-1886) kann – neben Gabriel Riesser und Johann Jacoby – als einer der engagiertesten Streiter für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie innerhalb dieses Diskurses angesehen werden. Seine Positionierung als „öffentlicher Gelehrter“, der seine Intellektualität als Verantwortung für die Gesellschaft verstand, kann retrospektiv als die charakteristische Facette seines publizistischen Wirkens angesehen werden, was vor allem durch seine zahlreichen öffentlichen Reden und Vorträge unterstrichen wird. Dabei schrieb und redete Zunz als jüdischer Intellektueller – 1819 gründete er in Berlin den Verein für Cultur und Wissenschaft der Juden, dem auch Heinrich Heine angehörte.
Seine politische Publizistik zwischen den 1840er und 1860er Jahren plädiert für die Realisierung bürgerlicher Freiheit und Gleichheit, an die er gleichzeitig eine jüdische Emanzipationshoffnung knüpft, welche durch das Gesetz gestützt werden soll: „Ein Recht besitzen heisst, die Freiheit es auszuüben haben, und gleiches Recht für Jedermann, demnach gleiche Freiheit: so ist der Rechtsstaat zugleich der Staat der Freiheit. Fort mit eingebildeten Unterschieden!“3 Auch während der revolutionären politischen Wirren der Jahre 1848/49, die Zunz in Berlin erlebte, postulierte er immer wieder die Grundsätze einer demokratisch verfassten politischen Gemeinschaft. In zahlreichen politischen Reden argumentierte Zunz leidenschaftlich für die aus seiner Sicht zwingende Symbiose von Staat, Nation und demokratisch-rechtsstaatlichen Verfassungsnormen: „Denn das Reich der Freiheit wird erstehen: das auf Nationalwillen gegründete Gesetz, die in freiwilligem Gehorsam bestehende Ordnung, die Anerkennung des Menschen unbehelligt vom Unterschiede der Sekten und Stände, die Herrschaft der Liebe als Zeugniss der Erkenntnis Gottes.“4
Auch nach dem Scheitern der Revolution, dem Rückzug vieler Juden aus dem öffentlich-politischen Bereich und der daran anschliessenden autoritären Restauration wird Leopold Zunz nicht müde, von der Souveränität des politischen Volkes zu reden und sich dabei auf den in Deutschland so verhassten Jean-Jacques Rousseau und dessen contract social zu beziehen. „Fortschritt, Freiheit und Wahrheit“ bilden dabei für Zunz den unhintergehbaren Kern der „Verfassungsseele“, den er auch gegen die politische Restauration in Deutschland verteidigte, die statt eines bürgerlichen Nationalverständnisses die Nation als genealogische Abstammungs- und kulturelle Exklusionsgemeinschaft definierte. Mit diesem aufklärerischen Impetus polemisierte er in einer Wahlrede in Berlin 1861 gegen die mächtigen Institutionen des Militärs und der Kirche: „Das Wesen beider, als altererbter Einrichtungen, sträubt sich noch in mehr als einer Richtung gegen das constitutionelle Gesetz.“5
Die Konsequenzen, die Zunz aus dieser Feststellung zog, war die Forderung nach einer Trennung zwischen Staat und Kirche sowie nach der politisch-rechtsstaatlichen Einhegung des Militärs. Zunz erkannte die gesellschaftspolitische Sprengkraft, die von einem militärischen Apparat ausgehen konnte, der „ausserhalb der Verfassung“ steht, und sah auch den im Kaiserreich aufkeimenden Konflikt zwischen der katholischen Kirche und dem preussischen Staat voraus.
Das politisch-publizistische Wirken Leopold Zunz‘ schöpft seine Überzeugungskraft aus dem bedingungslosen Eintreten für eine universalistische politische Ethik und Staatskonzeption, in der keine konfessionellen und sozialen Schranken das gesellschaftliche Zusammenleben reglementieren sollen – Staatsbürgerschaft und moderne Rechtsstaatlichkeit verkörpern für ihn politischen Fortschritt. Seine vielleicht radikalste Idee ist die der politischen Demokratie:
„Demokratie, d.h. das zur Geltungbringen des allgemein Menschlichen, damit der ganze Staat, die ganze Nation das Bewusstsein von sich bekomme, dass nur durch die gegenseitige Gerechtigkeit, durch die Gleichheit, also durch die gleiche Berechtigung der Freiheit bestehe, und dass die Freiheit das Mittel werde, dass die Nation, d.i. der Staat, Niemanden anders gehorcht, als sich selbst, weil sie selbst den sittlichen Gesamtwillen hat.“6
Schon 1849 formuliert Zunz die politisch-theoretischen Kernelemente demokratischer Verfassungen, wie sie für Deutschland erst genau hundert Jahre später, im Grundgesetz, festgehalten werden sollten. Das politische Denken Leopold Zunz‘, geprägt durch die Französische Revolution und die Amerikanische Verfassung, steht dabei zugleich für die Verschränkung von politischer und jüdischer Ethik. Der innerjüdische Diskurs des 19. Jahrhunderts deckte ein breites Spektrum an politischen und zivilgesellschaftlichen Problemfeldern ab, so etwa die Themen der bürgerlichen Gleichstellung, des Zusammenlebens zwischen Juden und Christen, aber auch von Regierungsformen und den damit verbundenen universalistisch-kosmopolitischen Souveränitätskonzeptionen. Dieser Diskurs, an den auch die vielfältigen Emanzipationshoffnungen der deutschen Juden geknüpft waren, wurde allerdings konsequent ignoriert und letztlich im Deutschen Kaiserreich durch den sich formierenden politischen und weltanschaulichen Antisemitismus diffamiert.
Es ist kein Zufall, dass mit der Verweigerung dieses Dialogs und der damit verbundenen kulturellen und politischen Exklusion des deutschen Judentums auch die zaghaften Bestrebungen nach einer demokratischer Regierungsform und einem universalistischem Staatsbürgerverständnis in Deutschland kein Gehör mehr fanden und die politische Kultur des Kaiserreichs zunehmend autoritäre Züge annahm.
Leopold Zunz, Gründungsvater der „Wissenschaft des Judentums“, ist einer der exponiertesten Vertreter deutsch-jüdischer Publizistik des 19. Jahrhunderts, welche die jüdischen Emanzipationsbestrebungen, die wissenschaftliche Beschäftigung mit den Grundlagen des Judentums sowie die Propagierung republikanischer Politikformen in Einklang brachten.
1 Vgl. Brocke, Michael/Jäger, Margarete/Jäger, Siegfried/Paul, Jobst/Tonks, Iris (2009): Visionen der gerechten Gesellschaft. Der Diskurs der deutsch-jüdischen Publizistik im 19. Jahrhundert, Köln u.a.: Böhlau.
2 Zahlreiche Texte dieser Autoren sind online unter http://www.deutsch-juedische-publizistik.de/ abrufbar.
3 Zunz, Leopold (1976): Gesammelte Schriften, 3 Bände in einem Band, Hildesheim/New York: Olms, 320.
4 Zunz, 302.
5 Zunz, 322.
6 Zunz, 303.